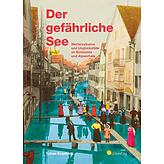Herr Engelsing, dem Ortsfremden erscheint der Bodenssee als Repräsentant von Naturschönheit und Glücksgefühl. Ist das immer so gewesen oder verbanden die Menschen früher Angst und Furcht mit dem Gewässer?
Wir nehmen den Bodensee heute ganz überwiegend als heitere Freizeitkulisse wahr, haben ihn ja auch in den letzten 100 Jahren zum großen Planschbecken verzwergt und Gefahren technisch minimiert. Doch unsere motorlosen Vorfahren waren seinen Urgewalten noch unmittelbar ausgesetzt: Als Fischer im eiskalten Gewässer, als Schiffer auf überladenen Lastkähnen, als Bauern, deren Felder und Wiesen alle paar Jahre im Hochwasser absoffen.

Der See hat viele Menschen das Leben gekostet. Wie viele könnten durch Naturereignisse wie Stürme und Hochwasser ihr Leben verloren haben? Ist der See ein riesiges Grab?
Ja, der Bodensee ist ein vielhundertfacher Friedhof, denn er war Jahrhunderte lang hochriskante Arbeitsfläche und ein gefährlicher Verkehrsweg. Vor der Dampfschifffahrt ab 1824 waren schwerfällige Holzkähne das übliche Verkehrsmittel, die waren schwer zu steuern und kenterten leicht. Die Chroniken handeln die hohen Opferzahlen eher beiläufig ab, Unglücksfälle waren alltäglich: „In einem Sturmgewell erbärmlich zugrunde gegangen“, heißt es dann meist lapidar, nachdem ein Marktschiff mit 30 Passagieren im Sturm gesunken war.
Ihr Buch zeigt, dass jahrhundertelang zwischen Bodensee und Nordsee eine Ähnlichkeit bestand. Die tödliche Gefahr war immer gegenwärtig. Waren die kuriosen Pläne, den See zu regulieren und schließlich seine Ufer zu industrialisieren, ein Auswuchs des Bestrebens, den Sieg der Technik über die Natur zu feiern?
Bis zur Vermessung und Technisierung der Welt durch die modernen Naturwissenschaften hielt man in Europa Überschwemmungen und Unwetter für Strafen, die Gotte den sündigen Menschen auferlegte. Im 19. Jahrhundert verschwand Gott als großer Steuermann aus der Natur, der Mensch begann, die Natur zu “korrigieren“ und zu „unterwerfen“ – mit großen Erfolgen und einigen gravierenden Spätfolgen, wie wir jetzt sehen. Am Bodensee und Hochrhein dachten deutsch-schweizerische Industriekreise sogar daran, den Rheinfall zu sprengen, Kraftwerke und Schleusen einzubauen und das Gewässer für Großtanker schiffbar zu machen.

Eine Art Duisburg-Ruhrort am Konstanzer Trichter: Wie groß war eigentlich die Gefahr, dass diese Pläne Wirklichkeit hätten werden können?
Die verschiedenen Industrie- und Schifffahrtsverbände im Zusammenwirken mit den damaligen Ufergemeinden glaubten wirklich, der Bau gigantischer Hafenanlagen und Industriereviere würde der Provinz Fortschritt und Wohlstand bringen. Und wenn das geklappt hätte, wollte man vom Bodensee aus weitere schiffbare Kanäle bis ins Schwarze Meer bauen. Der Streit um die Kostenverteilung, zwei Weltkriege und die Verlagerung des Güterverkehrs danach auf Schiene, Straße und in die Luft ließen alle diese Pläne scheitern.

Ihr Buch und die Ausstellung im Kulturzentrum handeln auch von gerammten, untergegangenen und explodierten Schiffen. Zum Wrack der „Jura“ zieht es immer wieder Taucher. Was steckt hinter der riskanten Freude am Unterwassertourismus?
Die Angst vor Katastrophen sitzt tief im Stammhirn des Menschen, aber wenn wir nur unbeteiligte Zuschauer sind, zieht die Gefahr magisch an: Denken Sie nur an die Erfolge von Filmen wie „Das Boot“ oder „Titanic“. Auch der Bodensee hat eine lockende Tiefe, was von dort kommt, fasziniert uns.

Überhaupt der Tourismus: Er floriert seit Beginn der Kursschifffahrt auf dem See. Er ist ein wichtiger Erwerbszweig, aber es kam – wie Sie zeigen – zu einem unter dem Strich auch fragwürdigen Segen für die Region, denn der See wurde zu einem verbauten und bewirtschafteten See.
Der Begriff vom „bewirtschafteten See“ ist sehr treffend. Bewirtschaftet wurden See und Ufer auch schon vor 150 Jahren, aber eben von bedeutend weniger Menschen und nachhaltiger als heute. Die sozialen oder ökologischen Kosten der einseitigen Überbewirtschaftung unserer Zeit delegieren wir an spätere Generationen: Die Folgen der Verkehrsüberlastung, der Versiegelung von ufernahen Grünflächen und die daraus erwachsenden Folgen der wild wuchernden Bodenspekulation wirken sich jetzt aus.
Der „Ritt über den Bodensee“, den Sie auch schildern, ist zu einem Synonym für eine fragwürdige Risikobereitschaft geworden. Wo, würden Sie sagen, riskieren wir am und mit dem See zu viel und übertreiben es mit seiner Ausbeutung?
Langfristig steht jeder Tourismus in der Gefahr, das zu beschädigen oder zu zerstören, was er eigentlich bewundert. Wenn der Sauerstoffgehalt des Bodensees infolge der Klimaerwärmung weiter abnimmt, müssen wir den Verkehr mit Verbrennungsmotoren auch auf dem See reduzieren. Dem Konstanzer Oberbürgermeister schwebt vor, in spätestens fünf Jahren den letzten Verbrennungsbootsmotor auf dem Bodensee zuzulassen. Das wird ein harter Brocken, denn wir leben an einem Dreiländersee mit drei nationalen Rechtsordnungen und erheblichen wirtschaftlichen Interessen.
Sie sagen die Folgen des Klimawandels schlagen immer stärker auf den Bodensee durch. Ist es nicht Zeit, hier eine Bremse zu ziehen und auch mal zu sagen: Nein, dieses Hotel, diese Saunalandschaft wird hier nicht gebaut?
Am Säntis schmelzen keine Polkappen und das Hochwasser hier ist kein Tsunami. Das heißt, die massiven Schädigungen des globalen Klimas werden nicht am Bodensee verbrochen. Aber wenn wir reichen Westeuropäer den Schwellenländern sagen wollen, was zu tun ist, sollten wir selber die klimaschädigenden Nebenwirkungen unserer Konsumgesellschaft abstellen. Das ist leicht gesagt, aber schwer umzusetzen, weil einer wirklichen Veränderung Wirtschaftsinteressen und menschliche Egoismen entgegenstehen. Was meinen Sie, werden all die begeisterten SUV-Fahrer sagen, wenn Sie von ihren benzinsaufenden Stadtpanzern Abschied nehmen sollen?
Zufrieren wird der See in Zeiten der Klimaerwärmung so schnell wohl nicht mehr, und damit bricht auch eine Gefahrenquelle weg. Wo sehen Sie neue Gefahren, wenn wir mit dem Bodensee so weitermachen wie bisher?
Der Globus erlebt unter anderem als Folge der Klimaerwärmung katastrophale Überschwemmungen, Orkane, Dürreperioden und extreme Sommer. Auch im Bodensee- und Voralpenraum verstärken sich die Extremwetterlagen mit weitreichenden Folgen für Flora, Fauna und Mensch. Wirklich dramatisch ist das in Afrika, wo der Druck zur Migration weiter wächst. Europa wird aber aller Willkommenskultur zum Trotz keine 100 Millionen Klimaflüchtlinge aufnehmen können. Ob am Bodensee oder in Brandenburg: Die weitere Erwärmung muss gestoppt werden. Wir brauchen: Weniger Individualverkehr, mehr ÖPNV, weniger Müll und mehr Druck von uns Wählern, damit Politiker endlich mutige Klimapolitik machen, die sowohl der Wirtschaft, als auch den Konsumenten klare Regeln vorgibt. Manche lächeln altväterlich über die schulschwänzenden Kinder der Friday-for-Future-Bewegung, aber immerhin: Schüler haben offenbar früher als das politische Establishment kapiert, dass es ernst wird im Treibhaus Erde.
Fragen: Alexander Michel
Tobias Engelsing: Der gefährliche See – Wetterxtreme und Unglücksfälle an Bodensee und Alpenrhein, reich illustriert, Hardcover, Südverlag Konstanz, 256 Seiten 24,90 €
Das Rosgartenmuseum Konstanz zeigt dazu die Ausstellung „Der Gefährliche See“ im Kulturzentrum am Münster bis zum
29. Dezember.
Zur Person
Tobias Engelsing (58) hat Geschichte, Jura und Politik studiert und an der Universität Konstanz promoviert. Seit 2007 leitet er als Direktor die vier Konstanzer städtischen Museen. Zuvor war er 14 Jahre lang Konstanzer Lokalchef des SÜDKURIER. In den letzten Jahren hat er mehrere Bücher unter anderem zur neueren Geschichte des Bodenseeraums verfasst. (sk)
Verlosung
Für seine Abonnenten verlost der SÜDKURIER zehn Exemplare von Tobias Engelsings neuem Band „Der gefährliche See.“ Wer mitmachen möchte, kann ab sofort bis Freitag, 12 Uhr, die Telefonnummer 01379/370 500 72 wählen, das Losungswort „Gefährlicher See“ aufsprechen und seine Abo-Nummer mitteilen. Das Buch wird mit der Post nach Hause geschickt. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! (sk)