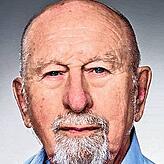Ihr Surren ist nervtötend. In Zeitlupe summt die Mücke am Gesicht vorbei und setzt sich an die Wand. Ein Glas lässt sich rasch über sie stülpen, dann verschließen und ab ins Gefrierfach. Am nächsten Morgen liegt das schockgefrorene Insekt leblos auf dem Rücken, wird in eine leere Streichholzschachtel gepackt und ein Einsendeformular ausgefüllt: Fundort, Datum, Name des Mückenjägers. Dann alles in einen Umschlag, Adresse, Absender drauf und – zur Post damit.
So kann jeder der Wissenschaft dienen. Denn das kleine Mückenpaket landet im Labor des ZALF, dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung im brandenburgischen Müncheberg, wo das tote Tier am nächsten Tag der Schachtel entnommen und genau untersucht wird. „Auch wenn es merkwürdig klingt, aber jede Mücke ist für uns Goldstaub“, sagt Doreen Werner. Sie ist Mückenexpertin am ZALF, das zusammen mit dem Friedrich-Löffle-Institut verantwortlich für den Mückenatlas ist.
In Deutschland gibt es 52 Stechmückenarten
Weltweit gibt es laut dem Mückenatlas 3500 Stechmückenarten, allein in Deutschland sind es 52. Stechmücken sind aber nicht nur lästig, sie können auch Krankheitserreger übertragen. Und genau dies birgt, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Corona-Pandemie, zunehmend Gefahren. Kaum jemand weiß noch, dass es im 19. und 20. Jahrhundert Malaria in Deutschland gab. Die Erreger dieser Tropenkrankheit werden beim Stich der weiblichen Anopheles-Mücke übertragen. Als Malaria in Mitteleuropa ausgerottet war, wandten sich Politik und Forschung von den Stechmücken ab. Das hatte Folgen.

„Wir haben Jahrzehnte ohne die Stechmückenforschung gelebt“, sagt Doreen Werner im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Als 2006 die Blauzungenkrankheit, eine Tierseuche bei Widerkäuern, auftrat, gelangten die Stechmücken in den Fokus der Wissenschaft. Die Viren, die sie verursachen, werden nämlich durch einheimische Stechmücken, die sogenannten Gnitzen übertragen.
Mücken-Expertin Werner war schon damals an der Forschung beteiligt. Man habe gedacht, dass die eigentliche Überträger-Mücke aus dem Mittelmeerraum verschleppt wurde und sich in Deutschland etabliert hat, so Werner. Fatal sei aber, dass es wohl mehrere einheimische Stechmückenarten sind, die diese Rolle auch übernehmen können. „Die Frage war, was dann erst die heimischen Stechmücken alles übertragen können.“ Daraufhin führten das ZALF und das Friedrich-Löffler-Institut ein Stechmücken-Monitoring durch. Über ganz Deutschland wurden 128 Mückenfallen aufgestellt. Zusätzlich wurde der Mückenatlas ins Leben gerufen. Schon im ersten Jahr gab es laut Werner über 2000 Einsendungen mit über 6000 Mücken.
Erste Asiatische Tigermücken in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg gingen Exemplare der Asiatischen Tigermücke in die Fallen. Seitdem richten die Forscher ihr Augenmerk besonders auf diese Art. Auf dem Mückenatlas erkennt man heute: Besonders am Oberrhein mit den Regionen Freiburg und Weil am Rhein, aber auch rund um Heidelberg ist diese Mückenart längst heimisch geworden. Die Tigermücke kann das Zika-Virus übertragen, bei dem, wie jüngst erst in Brasilien gesehen, der Fötus von Schwangeren schwer geschädigt werden kann.
Wie gefährlich ist die Tigermücke tatsächlich bei uns?
Noch werden die Gefahren, die von der Tigermücke ausgehen, als gering erachtet. Das Bundesumweltamt geht davon aus, dass „die Anzahl von Virusträgern gering und das Vorkommen der Stechmücken begrenzt“ ist. Doch das müsse nicht so bleiben. Laut dem Amt weisen „die zunehmenden Nachweise der Asiatischen Tigermücke in Deutschland darauf hin, dass sich die Stechmücke auch hierzulande etablieren und ausbreiten kann“.
Sorgen bereitet den Experten, dass in den vergangenen Jahren bereits in Frankreich und Kroatien Fälle des oftmals tödlichen Dengue-Fiebers sowie in Italien, Frankreich und Spanien Ausbrüche des Chikungunya-Fiebers aufgetreten sind. Beide Viruserkrankungen wurden von Stechmücken übertragen.
Düstere Aussichten für die nächsten Jahre
In Deutschland werden inzwischen fünf eingewanderte Mückenarten festgestellt, die sich etabliert haben. Werner: „Um eine Mückenart als einheimisch zu bezeichnen, muss sie mehrere Generationen an ihrem Standort vollzogen haben.“ Bei der Tigermücke sei dies noch etwas schwieriger festzustellen. „Als wärmeliebende Art muss sie den Winter überstanden haben.“ Baden-Württemberg gilt als das mit Abstand am meisten betroffene Bundesland, gefolgt von Bayern, Hessen und Thüringen.
„Wir rechnen damit, dass wir weitere invasive Arten (eingewanderte Tierarten) bekommen werden“, sagt Biologin Werner. Sie erwartet vor allem deren weitere Ausbreitung. „Die Globalisierung ist das A und O dieser Verbreitung der Mücken, aber die Klimaveränderung begünstigt deren Ansiedlung.“ Sie gehe davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, „bis wir auch hier Krankheiten haben, die wir in Deutschland bisher nicht hatten.“ Zum Beispiel Dengue und das Chikungunya-Fieber.
Der Hoch- und der Oberrhein sind laut Werner wegen ihres warmen Klimas für Tigermücken attraktiv. Neben dem Tourismus spiele aber auch der Güterverkehr eine große Rolle. Das Umweltbundesamt bestätigt, dass die Asiatische Tigermücke in 19 von 26 europäischen Ländern nachgewiesen ist. Italien ist laut Werner bereits flächendeckend mit der Tigermücke besiedelt.
Was kann der Mückenatlas künftig machen?
Der Mückenatlas lebt von Einsendungen aus allen Teilen Deutschlands. Im sogenannten Zika-Jahr 2016, in dem bekannt wurde, dass das südamerikanische Zika-Virus durch infizierte Stechmücken auch in Deutschland verbreitet wird, gab es zuletzt einen Schub. „In dem Jahr erhielten wir über 53.000 Mücken über dieses Projekt. Das waren natürlich die verschiedensten Mücken.“ Inzwischen wurden mehr als 140.000 Mücken untersucht.

Die Wissenschaftler können jede Stechmücke mit einer Koordinate versehen und auf der Karte im Internet markieren. Dort finden sich zum Beispiel Funde aus Singen und Rielasingen-Worblingen, aus Konstanz-Allmansdorf und Meersburg. Einsender erhalten ein persönliches Schreiben, in dem sie erfahren, um welche Mückenart es sich handelt und was man gegen eine Ausbreitung tun kann.
Bereichert wird der Atlas durch Einsendungen bestimmter Stechmückenarten, die das West-Nil-Fieber übertragen können, so wie 2020 geschehen. Damit lässt sich die Verbreitung der Mücken einkreisen, und es können Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, damit nicht die Gefahr besteht, dass die Mücke den Erreger ausbreiten kann, so Werner.
Für die Forscherin ist der Datensatz daher auch eine wichtige Bereicherung ihrer Arbeit. „Wir müssen wissen, wo, wann, welche Mücken auftreten, um zusammen mit den anderen Daten Handlungsempfehlungen zu geben.“ So könne jeder auch einen Beitrag zu seiner eigenen Gesundheitsvorsorge leisten, denn jede Einsendung wird entsprechend beantwortet.
Was macht die Tigermücke so widerstandsfähig?
Während die gemeine Hausmücke ihre Eier beispielsweise in einer Regentonne ablegt, kann die Tigermücke auch die kleinste Wasserpfütze von zwei oder drei Millimetern besiedeln. Laut Werner reicht schon eine Auffangschale unter dem Topf eines Oleanders aus. „Darin würden einheimische Mücken nie ihre Eier ablegen“, so Werner.

Mücken mögen es feucht und warm. „Wenn es zu warm ist und nicht regnet, wissen die Mücken nicht, wo sie die Eier ablegen sollen, weil dann die Feuchtigkeit fehlt. Und wenn es zu feucht und kalt ist, dann kommen die Larven langsamer zur Entwicklung.“ Eine Mückenplage ist in diesem Jahr aber laut Werner in weiter Ferne. „Eine Plage bedeutet, dass man über 20 Mückenstiche pro Minute bekommt. Das erlebe man, wenn man direkt in eine Aue gehe oder in ein Moor. „Wenn Sie an einem Grillabend zehn Stiche bekommen, fühlen Sie sich schon belästigt. Bei über 20 Mückenstichen pro Minute gehen wir gar nicht mehr vor die Tür.“
2021 wird am Bodensee wohl kein Mückenjahr mehr
Einer, der sich am Bodensee mit Schnaken auskennt, ist der Radolfzeller Biologe Rainer Bretthauer. Er hält es nach den intensiven Regenfällen für unwahrscheinlich, dass es am Bodensee zu einer Mückenplage in diesem Jahr kommt. „Ich glaube, dass wir ziemlich ruhig über den Sommer kommen werden“, sagt er. Der Schnee auf den Alpen sei weitgehend abgetaut, sodass kein Alpenwasser mehr dazu kommen wird. Die Bodenseeschnake habe nach den Massen an Wasser und dem relativ kühlen Wetter kaum eine Chance, ihre Population massiv zu erhöhen. „Unwetter und Kälte mögen die Schnaken-Weibchen überhaupt nicht.“ Nicht viel anders dürfte es im Schwarzwald sein, wo die Schnaken besonders gern in Büschen sitzen.
Wertvoller Tipp für alle Biertrinker
Bretthauer hat auch gleich einen Tipp für die Gartenparty: Die Mücken folgen ja gern dem CO2-Ausstoß, und der kommt bei Partys auch gern vom konsumierten Bier. Biertrinker stoßen auch schnell das CO2 wieder aus, so dass Bretthauer empfiehlt: Kein Bier und kein Sprudelwasser. „Wein ist etwas anderes, weil da der Lockeffekt fehlt. Nur eben kein Weinschorle.“
Was uns bei Mückenstichen wirklich hilft
Ihr Surren kann den schönsten Sommerabend vermiesen. Und dann erst diese juckenden Mückenstiche! Ständig will man sich kratzen. Gut dran ist, wer dann die richtigen Kniffe kennt
- Smartphone gegen Stiche: Das Hilfsmittel gegen den Juckreiz ist klein wie ein Daumennagel. Angesteckt ans Smartphone heizt sich das flache Ende des Stöpsels auf rund 50 Grad auf und wird dann für wenige Sekunden direkt auf den Mückenstich gedrückt. Eine App zeigt an, wann der kleine Stecker wieder von der Haut weggenommen werden sollte. Laut dem Hersteller heat_it sorgt der Hitzeschmerz dafür, dass die Nerven das Juckreizsignal nicht mehr so gut weiterleiten können. Und wenn es weniger juckt, will man sich auch nicht ständig kratzen. So weit ist das einleuchtend, auch für den Hautarzt Christoph Liebich. Er bestätigt: „Der leichte Hitzeschmerz löscht den Juckreiz kurz aus.“ Wobei diese Wirkung eher kurzfristig sei.
- Hitze gegen die Enzyme – wie „Eier-Kochen“: Doch die Hitze macht noch mehr. Der Zweck sei vor allem die Zerstörung des Enzyms, das die Mücken in ihrem Speichel haben, damit das menschliche Blut beim Saugen nicht gerinnt – das würde den feinen Rüssel der Mücke verstopfen. Das Problem: Ihr Speichel provoziert in unserem Körper eine Abwehrreaktion und beschert uns diesen unangenehmen Juckreiz. „Hitze direkt drauf ist gut. Die zerstört dieses Enzym, weil es aus Eiweiß besteht“, erklärt der Mediziner aus München. „Das ist wie beim Eier-Kochen.“ Wer sich keinen Mini-Hitze-Stick zum Anstecken an sein Smartphone kaufen möchte, findet im Handel auch batteriebetriebene Hitzestifte mit ähnlicher Funktionsweise.
- Kühlen und Cremes: Es kann auch angenehm sein, einen Mückenstich zu kühlen. Als Hausmittel-Alternativen nennt die Zeitschrift „Apotheken Umschau“ außerdem Umschläge mit essigsaurer Tonerde oder eine aufgeschnittene Zwiebel, die auf die Einstichstelle gedrückt wird.
- Cortisol gegen das Jucken: Juckt die Haut sehr stark, können entzündungshemmende Salben mit Cortisol helfen. „Die gibt es speziell für Insektenstiche. Am besten lässt man sich in der Apotheke beraten, welche Creme die passende ist – vor allem auch, wenn sie für Kinder gedacht ist“, rät Dermatologe Liebich. Auch Antihistaminika, also Mittel gegen allergiebedingte Beschwerden, machen die Situation erträglicher, wenn man gestochen wurde. Sie gibt es zum Auftragen auf die Haut oder in Tablettenform.
- Warum Kratzen die Sache nur schlimmer macht: Auf jeden Fall gilt „Finger weg vom Stich“. Wer kratzt, arbeitet die Enzyme im Mückenspeichel am Ende nur tiefer ins Gewebe ein und bringt über die Fingerkuppen schlimmstenfalls noch Schmutz und Keime in die Wunde – Infektionsgefahr. Man sollte auch nicht mit dem Arm auf der Stelle reiben, sagt Liebich. „Am besten ist es, gar nicht am Stich herum zu manipulieren.“ Anders sieht es drumherum aus: Jedenfalls gibt die Stiftung Warentest den Ratschlag, mit zwei Fingern die Haut um die Stichstelle herum einzukneifen. Da lasse der Juckreiz oft nach, heißt in der Zeitschrift „test“.
- Nicht jeder reagiert gleich auf Mückenstiche: „Hat man zum Beispiel ein hochempfindliches Immunsystem, reagiert man womöglich sensibler“, sagt Liebich. Wer in Folge des Stichs Kreislaufprobleme bekommt oder Schwierigkeiten beim Atmen hat, wer Fieber oder Schüttelfrost hat, der sollte zum Arzt gehen. Das gilt auch bei stark entzündeten Stichen.
- Schutz gegen Mücken: Zum Schutz gegen Mücken empfiehlt die Stiftung Warentest, abends – wenn die Mücken besonders aktiv sind – lange, dicht gewebte Kleidung zu tragen. Fliegengitter vor dem Fenster sowie Moskitonetze über dem Bett halten die kleinen Insekten ebenfalls ab. Von Mücken-Abwehrmitteln zum Auftragen auf die Haut haben laut der Stiftung jene mit den Wirkstoffen Diethyltoluamid (DEET), Icaridin oder Para-Menthan-3,8-diol (PMD) in Produkttests gut abgeschnitten. Nicht überzeugend seien Mittel auf Basis ätherischer Öle gewesen.
- Oft gehört, aber leider falsch: Der Tipp, dass man abends im Schlafzimmer das Licht auslassen sollte, weil das Mücken anziehe. Tatsächlich sehen Mücken schlecht und werden eher von Gerüchen wie Parfüm und dem Kohlenstoffdioxid in der Ausatemluft angelockt.