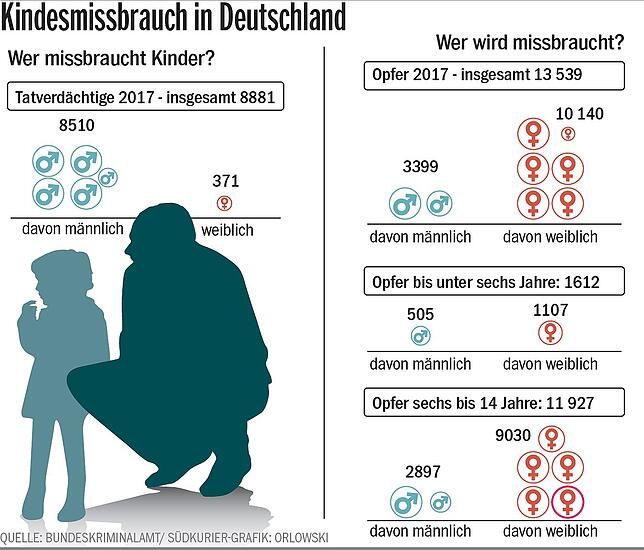Herr Bermejo, Sie haben die Ermittler bei ihrer Arbeit zum Staufener Missbrauchsfall betreut. Wie getroffen waren die Beamten?
Sie waren natürlich sehr, sehr betroffen. Vor allen Dingen, weil sie gemerkt haben, dass sie ihre Arbeit zwar professionell und effektiv machen können, aber das etwas bleibt. Mehr als bei den üblichen Fällen. Den üblichen Strategien, auf die die erfahrenen Ermittler zurückgreifen konnten, waren Grenzen gesetzt.
Hinzu kam, dass alles geheim gehalten werden musste. Es gab in diesem Fall also kaum Möglichkeiten, mit Dritten zu sprechen, damit Tatverdächtige nicht alarmiert oder Ermittler entlarvt werden. Die emotionale Belastung war für die Fahnder deshalb sehr hoch.
Die Ermittler mussten Tausende kinderpornografische Videos sichten, die Christian L. aus dem Darknet gezogen oder selbst weitergegeben hatte. Bekommt man diese Bilder jemals wieder aus dem Kopf?
Ganz aus dem Kopf bekommen Sie sie nicht. Das ist wie im Internet – was drin ist, ist drin. Vor allem, wenn es mit emotionalen Aspekten verknüpft ist. Diese Bilder in einer Erinnerungsecke zu verstecken, in der Hoffnung, sie kommen nicht mehr zum Vorschein, ist keine langfristig gute Strategie.
Erinnerungen, positiv wie negativ, tauchen immer wieder auf, das kennen wir alle, wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken. Daher ist es sinnvoller, solche negativen Erinnerungen einzuordnen. Sie gehören jetzt zu der eigenen Lebenswelt. Sie darin einzusortieren, ist die Aufgabe. Also nicht verdrängen, sondern integrieren.
Geht das denn so einfach?
Nein, da gibt es schon verschiedene Phasen. Am Anfang stellt man die Erinnerung sinnbildlich zur Seite, damit der normale Alltag nicht zu sehr beeinflusst wird. In dem Moment, in dem die Ermittlungsarbeit zu Ende geht, kann ich die Erinnerungen einsortieren. Dabei kann der Austausch in der Gruppe helfen: Welche Erfahrungen machen andere, die in einer ähnlichen Situation sind? Das entlastet und ich lerne neue Strategien kennen. Welche davon für mich selbst hilfreich sind, hängt von meinen Stärken ab.
Gibt es mentale Übungen oder Strategien, die helfen?
Es gibt nicht die eine Strategie, sondern ganz viele. Sie alle haben gemeinsam, dass sie das Erlebte – in dem Fall durch die Videos indirekt erlebt – in meine Lebenswelt einzuordnen helfen. Wie Bücher, die ich mir anschaue, sortiere und in mein Regal stelle. Da sind sie nicht weg, aber die Bücher und Erfahrungen treten dort auch nicht permanent in den Vordergrund.
Irgendwann stehen da so viele Bücher, dass sie in der Wahrnehmung kleiner werden. Was die Ermittler entwickeln müssen, sind Strategien, wie sie vorgehen, wenn die Bücher wieder aus dem Regal fallen. Da hat jeder seine eigenen Vorgehensweisen.

Was macht man denn, wenn so ein Buch aus dem Regal fällt?
Eine wichtige Strategie ist, sich zu fragen, was mir guttut, wenn das Buch herausfällt, d. h. Erinnerungen und Bilder wiederkommen. Was brauche ich jetzt für eine Unterstützung? Wir tendieren ja dazu, besonders in den helfenden Berufen, uns eher auf andere zu konzentrieren.
Hier geht es darum, auch für sich selbst zu sorgen. Außerdem ist es wichtig, sich zu fragen, wozu tue ich das, statt warum? Wozu ist positiv in die Zukunft gerichtet, warum dagegen in die Vergangenheit.
Und wenn das nicht hilft?
Ich muss wieder meine Erinnerungen und das Erlebte kontrollieren. Ich kann jemanden suchen, der mich unterstützt, andere Bilder und Erlebtes dagegensetzen. Die Beamten haben ja Dinge gesehen, die mit dem Jungen gemacht wurden. Dinge, die kaum zu ertragen sind. Wenn z. B. ein Bekannter nun ein Kind in den Arm nimmt, dann können Szenen aus den Videos wieder hochkommen.
In solchen Momenten kann ich mir zum Beispiel vor Augen führen, dass körperliche Nähe nichts Verwerfliches ist, auch wenn Menschen dies negativ genutzt haben. Das ist eine wichtige Strategie: dem nicht Normalen etwas Adäquates, in mein Lebensbild Passendes, entgegenzusetzen.
Der Staufener Missbrauchsfall ist in jeglicher Hinsicht ein Sonderfall. Die Ermittler sprechen sicher sehr bildhaft über das, was sie gesehen haben. Wie gehen Sie selbst damit um?
Ich kann und muss mich dann auf das, was in dem Ermittler passiert, konzentrieren. Ich fokussiere mich auf das, was er über sich berichtet, auf seine Sorgen und Schwierigkeiten Dadurch registriere ich die eigentlichen Bilder nicht richtig, weil ich auf etwas anderes konzentriert bin.
Das ist wie, wenn ich drinnen sitze – ich bekomme zwar mit, was draußen vor dem Fenster passiert, aber es ist weiter weg für mich. Ich betreibe sozusagen persönliche Psychohygiene, schütze mich davor, die Dinge zu nahe an mich heranzulassen. Mir hilft es dann auch, mit Kollegen zu sprechen. Meine Familie ist da auch sehr wichtig, für mich ist sie die wichtigste Quelle der Kraft.
Wie schaffen es Richter und Staatsanwälte, die dem Bösen mehr oder weniger täglich ins Gesicht blicken, professionelle Unparteilichkeit zu wahren?
Sie müssen trennen zwischen individuellen Gefühlen und der professionellen Bewertung. Die menschlichen Empfindungen darf man nicht wegdrängen, damit tut man sich keinen Gefallen. Ein Richter beispielsweise muss akzeptieren, dass er verschiedene Rollen innehat – er ist Vater, Sohn, Freund, aber eben auch Richter. In diesen verschiedenen Rollen kann ich auch unterschiedliche Empfindungen haben und unterschiedlich damit umgehen.
Ich kann also akzeptieren, dass mich das wütend, aggressiv oder traurig macht. Im nächsten Schritt kann ich mir überlegen, wie ich damit umgehe: Lasse ich das Gefühl zu, oder sage ich: Du bist da, aber mein Verhalten bleibt auf professioneller Ebene.
Ist das nicht ein Widerspruch?
Wir Menschen können mit Widersprüchen klarkommen. Denken Sie an den rauchenden Arzt: Er weiß ganz genau, dass das, was er tut, ungesund ist. Trotzdem tut er es. Ähnlich ist es bei Richtern und Staatsanwälten: Gefühle muss ich annehmen, mein Handeln aber nicht dadurch bestimmen lassen, sondern professionell bleiben. Wenn sie mich in meinem Beruf behindern, muss ich lernen, sie zu kontrollieren, aber nicht zu verdrängen.
Gibt es Polizisten oder Staatsanwälte, die regelrechten Hass auf die Täter entwickeln?
Ich weiß nicht, ob sie wirklich Hass empfinden. Hass ist etwas sehr Persönliches, intensives. Eine so persönliche Ebene macht den Umgang mit Tätern schwierig. Wenn ich dagegen sage, dass, was er da macht, widerspricht meinen Vorstellungen so sehr, dass ich es mehr als ablehne, dann bin ich auf dem kontrollierten Weg.
Ich denke, dass die Ermittler oder Staatsanwälte keinen Hass empfinden, sondern eher Abneigung und Ekel. Wenn ich diese Empfindungen frühzeitig kontrolliere, dann entsteht dieser extreme Hass, den ich nicht mehr kontrollieren kann, gar nicht erst.
Kam es schon häufiger vor, dass Polizisten wegen eines Falls dienstunfähig geworden sind?
Dass sie dienstunfähig werden, gibt es immer wieder, aber Gott sei Dank nicht so oft. Wenn Polizisten ihre individuellen Grenzen erkennen und frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen, können sie verhindern, dass sie ausfallen. Bei der Sichtung der Beweisvideos konnten sich die Ermittler beispielsweise abwechseln – so konnten sie immer wieder regenerieren, während sie sich einer anderen Aufgabe widmeten.
Das ist wie bei einem Auto, das man immer im roten Bereich fährt. Wenn ich immer übertourig fahre, dann geht der Motor irgendwann kaputt. Zwischendurch muss das Tempo runter, muss Zeit und Raum zum Energietanken geschaffen werden.
Wie sehr reißt die Aussage vor Gericht die Beamten wieder in ein Loch?
Es kann sein, dass dadurch ein Wiedererleben entsteht. Aber die Ermittler sind es gewohnt, dass sie vor Gericht aussagen müssen. Sie gehen kontrolliert in die Situation. Um zum Bild des Regals zurückzukommen: Es ist nicht so, dass das Buch plötzlich herausfällt, sondern es fällt in meine Hände und ich kann es zurückstellen.
In diesem Fall ist es so, dass die Ermittlungsgruppe zwar de facto nicht mehr besteht, aber der Austausch und die gegenseitige Unterstützung sind noch da. Es gibt also Menschen, mit denen sie sich austauschen können.
Inwiefern unterscheidet sich diese Betreuung von der „normaler“ Klienten?
Eigentlich nur durch den Auslöser. Bei dem einen sind es diese Bilder und Videos des Missbrauchs, die die Ermittler gesehen haben. Bei dem anderen ist es das persönliche Leid der Patienten. Meine Arbeit beschäftigt sich aber weniger mit dem Auslöser, sondern eher mit dem Umgang damit. Die Gründe für die Gefühle sind für mich eher zum Verständnis wichtig. Meistens ist es so, dass ich diese Auslöser nicht ändern kann.
Wenn ich das Problem nicht lösen kann, muss ich mich von dem Problem lösen. Ich muss überlegen, wie ich damit klarkomme, also wie ich negative Folgen des Problems reduzieren kann. Ich kann mir Möglichkeiten schaffen, dass ich nicht kaputtgehe, dass ich mich ein Stück weit von dem Bösen löse und mich einem anderen Bereich widme, der mir hilft.
Zur Person
Isaac Bermejo (54) ist Diplom-Psychologe und Verhaltenstherapeut. Er ist seit 2015 Leiter des Supervisions- und Coachingdienstes für Beschäftigte am Universitätsklinikum Freiburg. Geboren in Hamburg als Sohn spanischer Gastarbeiter, kam er mit seiner Familie als Kleinkind nach Freiburg. Hier hat er nach dem Abitur Psychologie studiert, in dem Fach promoviert und sich habilitiert. Seit fast 20 Jahren arbeitet er auch mit der Polizei zusammen. Er wohnt mit Frau und Sohn in Freiburg.
Ermittlungen bei Kindesmissbrauch
Im Staufener Missbrauchsfall hat ein anonymer Hinweis die Ermittlungen angestoßen. Innerhalb weniger Tage hat die Kripo Christian L. und Berrin T. festgenommen, die sich gemeinsam an einem dreijährigen Mädchen und dem Sohn der Frau vergangen hatten.
Nach wenigen Wochen nahmen die Fahnder mehrere Männer fest, die sich ebenfalls an dem Jungen vergangen hatten.
- Wie lange dauert es vom Beginn einer Ermittlung, bis Anklage erhoben wird? Das ist unterschiedlich, je nach Umfang und Schwere der Tat. Ein konkretes Zeitfenster kann nicht geplant werden.
- Was steuern die Ermittler zum Prozess bei? Im Rahmen des Gerichtsverfahrens werden die Fahnder als Zeugen vernommen. Vorab werden die kompletten Ermittlungsakten an die Staatsanwaltschaft übergeben.
- Wann wird der Staatsanwalt hinzugezogen? Der Staatsanwalt kann schon während der Ermittlungen beteiligt werden und „Ermittlungsaufträge“ erteilen. Maßnahmen wie Wohnungsdurchsuchungen können ohnehin nur in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und mit richterlichem Beschluss durchgeführt werden, es sei denn, es ist Gefahr in Verzug.
- Gibt es eine bestimmte Vorgehensweise bei den Ermittlungen zu Kindesmissbrauch? Nein, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
- Werden dafür spezielle Ermittler eingesetzt oder sind das immer wieder wechselnde Beamte? Dafür gibt es eine eigene Abteilung bei der Kriminalpolizei. Hinzu kommen je nach Fall weitere Fachleute – vom Kriminaltechniker bis zum Staatsschutz.
- Wie groß war die Ermittlergruppe im Staufener Fall? Genaue Zahlen will die Kripo Freiburg dazu nicht veröffentlichen. An den Ermittlungen waren aber Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, die Kriminalpolizei der Schweiz sowie das Polizeipräsidium Freiburg beteiligt.
- Wie werden die Daten und das Beweismaterial eigentlich ausgewertet? Sie müssen von den Ermittlern im Detail gesichtet werden – jedes einzelne Video, jedes Bild.