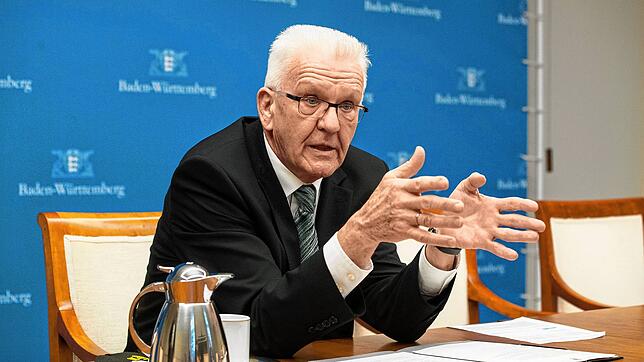Herr Kretschmann, lesen Sie auf Facebook, Twitter & Co, was über Ihre Corona-Politik so geschrieben wird?
Nein. Das wird von meinen Mitarbeitern beobachtet und bearbeitet, es gibt aber jeden Morgen einen Bericht über die sozialen Medien. Ab und zu bekomme ich mal Ausdrucke, und wenn es strafrechtlich relevant wird, geht es an die Polizei. Solche Sachen landen ja auch in meinem Privatbriefkasten, und das reicht mir dann schon.
Das Internet eröffnet erstmals vielen Menschen, die sich nicht wahrgenommen und vertreten fühlen, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Kann sich die Politik erlauben, diese Menschen zu ignorieren?
Wir führen mit jedem einen Dialog, der bereit ist dazu. Auch unser Bürgertelefon ist immer geschaltet. Meine Staatsrätin hat ein Bürgerforum zu Corona gemacht. Dann gab es jüngst erst ein Gespräch mit Impfgegnern und Impfskeptikern, allerdings mit solchen, die überhaupt reden wollen. Manche lehnen das partout ab. Wenn jemand nur Schimpftiraden oder Schlimmeres von sich gibt, dann macht das wenig Sinn. Warum soll ich mich dem aussetzen?
Muss man die Menschen abschreiben, die von der Politik und Medien nicht mehr erreicht werden können und sich nur noch in ihrer Bubble bewegen?
Die sind uns nicht egal und das nehme ich auch ernst. Aber wir haben in einer Demokratie zum Schluss immer nur Argumente.
Ich nenne mal ein Beispiel: Da gab es einen Aufruf von 300 Ärzten gegen das Impfen. Ich habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach darum gebeten, dass er und seine Leute diesen Brief widerlegen müssen. Ein Brief, der von 300 Ärzten unterschrieben ist, ist für notorische Gegner eine Legitimationsbasis. Das können wir nicht unwidersprochen stehen lassen.
Auch als Ministerpräsident kann ich nicht verhindern, dass Menschen auf eine falsche Spur kommen. Und Leuten, die aggressiv gegen den Staat agitieren, muss der Staat die Grenzen aufzeigen und Härte zeigen.
Wir können keinen Dialog mit Rechtsradikalen führen. Wir müssen harte Grenzen setzen da, wo der Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen wird. Das ist das Prinzip der wehrhaften Demokratie. Deshalb haben wir auch jetzt einen Kabinettsausschuss gegen Exzesse im Netz. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Vielmehr müssen wir sowas entschlossen verfolgen und sofort aktiv werden, wenn Straftatbestände begangen werden.
Und – so schwer es auch fällt – Verschwörungsideologen und Reichsbürger müssen wir ertragen, solange es nicht strafrechtlich relevant wird. Dialoge mit denen zu führen, wird nicht gelingen. Wir müssen versuchen, diejenigen zu erreichen, die noch nicht für unsere Demokratie verloren sind.

Wo kommen Sie da an Ihre Grenzen?
Jeder hat heute Impfskeptiker oder Impfgegner in seinem Bekanntenkreis, ich auch. Mit denen zu diskutieren, bringt insofern was, weil ich erkenne, wo die Grenzen sind.
Denn sobald die Frage des Impfens ins Weltanschauliche geht, sobald es ein ganz anderes Weltbild von Gesundheit, vom Körper, von Krankheiten und ihrem Sinn gibt, gerät der freiheitliche Staat an seine Grenzen. Denn er ist neutral gegenüber Weltanschauungen, akzeptiert auch den Eigensinn seiner Bürger, muss Unvernunft und Irrationalität akzeptieren. Deswegen herrscht Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit.
Wir können ja nur in diesem Extremfall einer Pandemie überhaupt ernsthaft über eine Impfpflicht nachdenken. Und jetzt kommt das Paradoxe: Die Impfpflicht soll ja gerade dazu führen, wieder den Zustand zu erreichen, der den Eigensinn der Bürger wieder zulässt.
Ist unser Staat, unsere föderale demokratische Republik, in der Bewältigung solcher Krisen gegenüber autoritären Staaten im Nachteil?
Nein. Ich halte nichts von dieser These. Der Föderalismus hat sich in der Krise bewährt, weil wir voneinander lernen konnten, weil wir vor allem über die Kommunen und Landkreise gute Steuerungsstrukturen haben. Welcher Staat ist besser durch die Krise gekommen? Wo wurden denn die Impfstoffe entwickelt? Bei uns.
Oft wurde die Kommunikation der Krisenmaßnahmen durch Politik kritisiert. Was haben Sie in dieser Hinsicht aus den letzten zwei Jahren gelernt?
Die Kommunikation an sich ist nicht das Problem. Das Neue an Corona ist doch: Es betrifft alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Trotz sorgfältiger Abwägung lässt es sich praktisch nicht vermeiden, dass bei den Corona-Regelungen auch Widersprüche entstehen.
Und dann ist es das Wesen von Regeln und Gesetzen, möglichst abstrakt – also nicht zu sehr auf den konkreten Einzelfall bezogen – zu sein. Das Leben ist aber vielfältiger, als es eine Rechtsverordnung abbilden kann. Das ist das Grundproblem.
Dazu kommt, die Maßnahmen müssen sowohl verhältnismäßig als auch wirksam sein, das macht es so kompliziert. Und das in eine verständliche Form für die Bürger zu bringen, ist schwierig. Aber wir können uns nicht beschweren, die seriöse Presse und der Rundfunk übersetzen das immer sehr gut.
Überlässt die Politik eigentlich den Virologen gerade die Kommunikation und Deutungshoheit über die Pandemie?
Max Weber hat darauf verwiesen, dass Wissenschaften die Welt beschreiben, wie sie war, ist und sein wird. Sie können auch beschreiben, wie man die Welt verändern könnte. Aber die Wissenschaft kann nicht sagen, ob man die Welt auch verändern soll. Heißt: Die Deutungshoheit über ihr Fach sollen sie auch unbedingt haben. Aber sie sollten auch dabei bleiben und es unterlassen, politische Ratschläge zu geben. Das kann ihre wissenschaftliche Autorität erheblich beeinträchtigen.
Zum Beispiel, ob jetzt eine Impfpflicht politische Kollateralschäden erzeugt – was sie zweifellos auch tun wird -, das zu bewerten liegt jetzt nicht in der Kompetenz der Stiko oder von wem auch immer. Das ist die Kompetenz und Aufgabe der Politiker, die dafür gewählt wurden. Nicht der Epidemiologen. Da ist manches verrutscht.
Sie wollen eine allgemeine Impfpflicht. Warum haben Sie nicht über den Bundesrat eine eigene Gesetzesinitiative gestartet?
Weil das Zeitfenster sehr schnell geschlossen war. Es gab ja die Idee, dass der Bundesrat es macht. Der Bundestag, in dem keine klare Mehrheit sichtbar ist, hätte sich anschließen können. Dann hat sich der Bundestag aber für das Verfahren des Gruppenantrags entschieden. Damit ist jetzt der Bundestag in der Pflicht. Und da muss jetzt viel mehr Tempo vorgelegt werden.
Bei der Impfpflicht-Debatte müssen Abgeordnete Stellung beziehen. Tun sich Politiker heutzutage, die im digitalen Zeitalter medial omnipräsent sind, immer schwerer, eine klare Haltung zu haben?
Nein. Grundsätzlich nicht, aber in der Pandemie ist es schwieriger geworden. Es entstehen neue Mutanten und dadurch verändert sich die Situation andauernd. Und daraus ergibt sich zwangsläufig ein Nachsteuern, ein Korrigieren und Anpassen des Kurses, weil wir diese Abwägungen im Lichte neuer Erkenntnisse immer wieder neu treffen müssen. Aber wenn sich die Tatsachen ändern, muss man auch das Handeln anpassen. Alles andere wäre verantwortungslos.
Apropos Fehlerkultur, Sie haben eine schonungslose Analyse des Wahlergebnisses gefordert…
Ich habe gesagt, wenn ich als Partei mit acht Prozent zufrieden bin, kann ich mich anders verhalten, als wenn ich 18 oder 28 Prozent erreichen will. Dann ist öffentlich ein ganz anderes Auftreten nötig. Je mehr Wähler, um so heterogener die Wählerschaft. Wenn eine Partei breite Teile der Gesellschaft erreichen und bei Wahlen erfolgreich sein will, dann muss sie ihr Themenspektrum erweitern und auch Meinungsvielfalt ertragen.
Baerbock konnte die Menschen nicht so überzeugen, dass es zur Kanzlerschaft gereicht hat. Wie kann die Partei die Wahlniederlage aufarbeiten, ohne die Außenministerin zu beschädigen?
Wir wollten die Kanzlerin stellen und sind auf knapp 15 Prozent gekommen. Da klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Annalena Baerbock war in unseren Reihen völlig unumstritten. Aber es ist nicht gelungen, ihre parteiinterne Beliebtheit auf die Bevölkerung zu übertragen.
Wir sind als Bündnispartei in den Wahlkampf gestartet und als Milieupartei gelandet. Nun müssen wir wieder auf den Pfad der Bündnispartei zurückfinden.
Am Wochenende sollen Ricarda Lang und Omid Nouripour zu den neuen Bundesvorsitzenden gewählt werden. Beide haben ihr Studium angebrochen und sind Berufspolitiker geworden. Ist das die richtige Mischung?
Das sind die Kandidaten und es sind gute Kandidaten. Die Frage des Lebenslaufs darf man nicht überhöhen. Am Ende zählt der Erfolg, persönlich und auch als Partei. Und die Frage, wofür man steht und ob man das glaubwürdig vermitteln kann. Ob die Entscheidung gut gewesen ist, weiß man sowieso erst hinterher.
Stehen die beiden vor besonders großen Herausforderungen, weil sie die Partei in Zeiten der Ampelkoalition führen müssen?
Jetzt ist erst mal entscheidend, dass wir gut regieren. Wir müssen die Agenden unseres Koalitionsvertrags umsetzen. Da müssen die beiden neuen Vorsitzenden schauen, dass die Partei mitgeht und den Prozess begleitet.
Ich regiere ja auch seit mehr als zehn Jahren und das geht nur mit der Unterstützung der Partei, die aber immer selbstbewusst und eigenständig geblieben ist. Aufgabe der beiden Neuen ist, die Regierung zu stützen und gleichzeitig das eigene Profil zu wahren. Eine Partei in der Opposition zu führen ist viel schwieriger als in der Regierung.
In der letzten Bundesregierung mit grüner Beteiligung sagte der damalige SPD-Kanzler Schröder zu den Grünen, es müsse klar sein, wer Koch und Kellner sei. Ist die SPD der Koch?
Das ist einfach ein schiefes Bild, das man als Regierungschef nicht verwenden sollte. Klar, der Regierungschef führt im Rahmen des Koalitionsvertrags. Aber niemand wird von uns oder der FDP den Eindruck haben, Kellner von Olaf Scholz zu sein.
Die Aussage von Schröder war ein Macho-Bild, das nicht funktioniert hat. Es widerspricht auch meinem Politikverständnis. Hätte Schröder damals nicht von vornherein eine solche Spur eingeschlagen, hätte er vermutlich länger regiert, als er es getan hat.