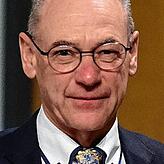Das politische Gerangel um die Nachfolge des Neun-Euro-Tickets hat lange gedauert. Ende vergangener Woche schließlich konnten sich Bund und Länder über die Finanzierung des Deutschlandtickets einigen. Es soll voraussichtlich ab April 2023 zu einem Einführungspreis von 49 Euro im Monat kommen. Der Preis könnte später noch erhöht oder gesenkt werden.
Vor allem der Streit zwischen Bund und Ländern zur Finanzierung des Monatsabos, das deutschlandweit im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr gelten soll, sorgte für Kritik. So hatten die kommunalen Spitzenverbände noch Ende November in einem gemeinsamen Schreiben betont, das Deutschlandticket könne nur eingeführt werden, „wenn die dadurch ausgelösten Kosten vollständig kompensiert werden.“
Nahverkehrsangebot stand auf der Kippe
In gleicher Richtung äußerten sich Landräte aus Südbaden gegenüber dem SÜDKURIER. „Ohne den finanziellen Ausgleich hätte sicherlich nicht ausgeschlossen werden können, dass die Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde Angebote wieder zurückfahren müssen, um finanziellen Schaden abzuwenden“, betont etwa Bondenseekreis-Landrat Lothar Wölfle.
Und sein Pendant vom Landkreis Konstanz, Zeno Danner, sagt, ohne finanzielle Unterstützung durch den Bund hätte man prüfen müssen, „ob der Regionalbusverkehr dann noch finanziert werden kann. Man kann kein Geld ausgeben, das man nicht hat.“
Kommunalpolitiker sehen Deutschlandticket weiter kritisch
Doch wie stehen die Landräte zwischen Bodensee, Hochrhein und Südschwarzwald dem Deutschlandticket generell gegenüber? Neben verhaltenem Lob gibt es vor allem viele Bedenken, wie eine SÜDKURIER-Umfrage zeigt.
So erklärt etwa Landrat Martin Kistler aus Waldshut: „Neben der Finanzierung sind noch einige weitere Herausforderungen wie die Einnahmenaufteilung, Einnahmensicherung der Verkehrsunternehmen, Ausgestaltung des Tarifangebotes, ausreichende Kapazitäten und gute Vertriebswege zu meistern.“
Das Ticket berge die Chance „die ÖPNV-Welt positiv zu verändern, aber auch das Risiko finanzieller Art und in der Umsetzung“, so Kistler weiter. Auch Zeno Danner aus Konstanz sieht mögliche positive Effekte: „Für die Fahrgäste wäre das eine radikale Vereinfachung der Tarife.“
Danner betont aber zugleich, dass das Deutschlandticket mit enormen Herausforderungen verbunden sei. „So passen die Verkehrsangebote, vor allem die Kapazitäten, nicht zu der erwarteten höheren Nachfrage. Auch die Infrastruktur muss verbessert werden.“
Landrat Lothar Wölfle vom Bodenseekreis stellt die geplante Einführung des Deutschlandtickets zum jetzigen Zeitpunkt gar an sich infrage. Denn stimme das ÖPNV-Angebot – „also sind Bus und Bahn pünktlich, kommen in ausreichender Taktung und bringen die Menschen von ihrem Wohnort zuverlässig ans Ziel“ – halte er Preisanreize zwar durchaus für sinnvoll, so Wölfle. Aktuell sein man von so einem Angebot aber noch ein gutes Stück entfernt.
Deshalb halte er Maßnahmen wie das Deutschlandticket für zu verfrüht. Dies hat aus seiner Sicht bereits das Neun-Euro-Ticket bestätigt, als der Ansturm auf den ÖPNV das Angebot überfordert habe. „Ich denke, dass wir alle deutlich mehr davon hätten, wenn das Geld für solche Maßnahmen erst dafür genutzt wird, die Angebotsinfrastruktur zu verbessern und später Preisanreize zu setzen“, sagt Wölfle.
Landrat Sven Hinterseh vom Schwarzwald-Baar-Kreis sieht es ähnlich wie sein Kollege aus dem Bodenseekreis, und betont, dass ein günstiger Preis für die Attraktivität des ÖPNV zweitrangig sei.
Es käme in erster Linie auf ein attraktives Verkehrsangebot an. Und weiter merkt er an, ob die bundesweite Gültigkeit eines Deutschlandtickets, „der Königsweg ist, ist noch offen, zumal wesentliche Fragestellungen wie zum Beispiel die künftige Verteilung der Einnahmen, noch nicht dauerhaft gelöst sind.“