Der Mord an der 14-jährigen Schülerin Ayleen aus Gottenheim bei Freiburg hat in ganz Deutschland für Entsetzen gesorgt. Bei vielen Menschen bleibt eine große Verbitterung darüber zurück, dass der als dringend tatverdächtig geltende 29-jährige Jan Heiko P. einschlägig amtsbekannt ist.
Bereits als 14-Jähriger versuchte er, ein 11-jähriges Mädchen zu vergewaltigen und verletzte das Kind dabei. Vor Gericht stellte sich heraus, dass der Täter psychisch schwer gestört und damit nicht schuldfähig ist. Aus diesem Grund erhielt er keine Freiheitsstrafe, sondern wurde knapp zehn Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt, ehe er im Jahr 2017 entlassen wurde.
Einzigartige Pionierstudie
Als rückfallgefährdeter Sexualstraftäter stand P. daraufhin unter sogenannter Führungsaufsicht der „Zentralstelle zur Überwachung Rückfallgefährdeter Sexualstraftäter“ (Zürs). Diese Kontrolle wurde jedoch zu Jahresbeginn 2022 beendet – ein verhängnisvoller Fehler, der der 14-jährigen Ayleen das Leben gekostet haben könnte.
Daran, dass sich ein derartiger Fall nicht mehr wiederholen kann, arbeiten gerade Forscher mit einem einzigartigen Projekt: Daniela Mier und Matthias Burghart von der Universität Konstanz untersuchen, wie psychisch kranke Gewalt- und Sexualstraftäter bei Therapien und Befragungen ihre Emotionen steuern – und das bis hin zum Vortäuschen von Mitgefühl, etwa um als geheilt eingestuft und aus psychiatrischen Krankenhäusern entlassen zu werden.
Gesund oder Rückfallgefahr?
„Das ist schon erstaunlich, dass es dazu quasi keine Studien in der Fachliteratur gibt“, sagt Psychologin Daniela Mier im Gespräch mit dem SÜDKURIER – zumal das Thema große Bedeutung für Sozialprognosen und Gutachten habe. Diese entscheiden oft darüber, ob und wann ein psychisch kranker Gewalttäter als gesund gilt und wieder auf freien Fuß kommt.

Unterstützt wird das Duo bei ihren Forschungen von Jan Bulla vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Reichenau. Er leitet dort den Maßregelvollzug, wo auf richterliche Anordnung psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht und therapiert werden, um die Bevölkerung vor ihnen zu schützen. So war es auch für knapp ein Jahrzehnt bei Jan Heiko P. der Fall, der nun traurige Bekanntheit erlangt hat.
Mitgefühl hemmt Gewaltimpulse
„Die Neigung, anderen Menschen Gewalt anzutun oder sich über Regeln hinwegzusetzen, ist in jedem Menschen angelegt“, sagt Bulla. Diese Veranlagung werde durch Mechanismen ausgebremst, indem man sich in die Folgen für Andere hineinversetzt.
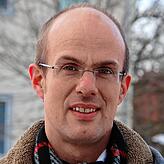
Zwar könne jeder Mensch zum Mörder werden, doch in den allermeisten Fällen spiele sich das nur in der Fantasie ab, weil die Angst vor Bestrafung und die Folgen – etwa eine lebenslange Freiheitsstrafe – mitbedacht werden. „Auch das Gespür, welche Schmerzen eine Tötung für Angehörige bedeuten würde, hemmt solche Impulse im Regelfall“, so der medizinische Direktor des ZfP.
Gefühlskalt und manipulativ
Doch bei manchen Menschen gebe es ein Defizit, mit anderen mitzufühlen und sich vorzustellen, welche Trauer und welches Leid jemand durch eine Handlung erfahren würde, sagt Forscherin Mier. Echte Psychopathen, also Menschen, die gefühlskalt, manipulativ und nur auf den kurzfristigen Vorteil bedacht sind, seien laut Jan Bulla eine Rarität. Sie könnten sich zwar gut in andere Menschen reinversetzen, würden aber nicht spüren, was sie anrichten und Schmerz gegenüber völlig gleichgültig sein, so der ZfP-Direktor.

Gesunde Menschen schließen von sich automatisch auf andere. Wenn sie sehen, dass ihr Gegenüber lächelt, reagiert exakt der selbe Bereich im Gehirn wie wenn sie selbst lächeln würden. Doch bei Menschen mit antisozialen Störungen dürfte dieses Spiegelungsprinzip nicht funktionieren. Aus diesem Grund können sie anderen Menschen heftige Schmerzen zufügen, ohne dass sie von Mitgefühl gestoppt würden.
Welche Emotionen löst ein weinendes Kind aus?
Daneben untersuchen Daniela Mier und Matthias Burghart noch einen zweiten Aspekt, der ebenso noch eher unerforscht ist: Es gibt Hinweise, dass Menschen mit antisozialen Störungen ihre Emotionen nicht gut regulieren können und – dies ist hirnpsychologisch nachweisbar – nur sehr reduziert spüren. Dabei gibt es eine Emotion als Ausnahme: Ärger. Doch durch ihre mangelnde Fähigkeit, ihre Emotionen zu regulieren, können kranke Menschen diesen nur schwer in den Griff bekommen.

Ob beide Aspekte – also das Spiegelungsprinzip und die Kontrolle von Emotionen – auch in Kombination miteinander eine Rolle spielt, das will das Forscherteam zunächst anhand von Fragebögen und Bildmaterial herausfinden.
Psychisch kranke Straftäter werden vor einen Computer gesetzt. Sie sehen negative Szenenbilder, etwa ein weinendes Kind oder eine Person, die verstorben ist und ein schreiendes Baby im Arm hält. Dann sehen sie etwas Vergleichbares, etwa eine Person, die etwa mit Ketchup so tut, als sei sie verletzt. „Wir schauen uns dabei an, wie effektiv die Patienten ihre Emotionen verändern können“, sagt Mier.
Je mehr Therapie desto besser die Täuschung?
Besonders heikel ist eine Vermutung der Forscher: Psychisch kranke Menschen dürften im Laufe ihrer Behandlung lernen, wie sie auf bestimmte Fragen reagieren müssen, um als geheilt begutachtet zu werden. Wird ihnen etwa ein Bild eines leidenden Menschen gezeigt, geben sie ohne Weiteres an, mit der Person mitzuempfinden.
„Es besteht die Befürchtung, dass die Veränderung im Mitgefühl vorgetäuscht ist, und je mehr Therapie sie bekommen desto besser werden sie darin“, sagt die Uni-Psychologin. Was Gesunde automatisch machen, dürften sich manche psychisch Kranke kognitiv herleiten.
Aus diesem Grund setzt das Konstanzer Forscherteam auf eine doppelte Methodik: Neben Fragebögen und Bildvorlagen kommen in weiteren Studien auch zwei körperliche Untersuchungen zum Einsatz. Bei der Hautleitfähigkeit werde untersucht, wie sich die Schweißproduktion in Reaktion zu einem Stimulus, etwa einem negativen Szenebild, verändert.
„Es gibt automatische Marker in unseren Körpern, die man nicht steuern kann und die sich auch Tests mit Lügendetektoren zu Nutze machen“, erklärt Mier. Schlägt dabei auch das Herz eines Menschen etwas schneller, dann deutet dies auf Emotion und Mitgefühl hin.
Wie sich die Kindheit auswirkt
Einfluss auf die Fähigkeit Mitleid zu empfinden hat offenbar auch, wie die Kindheit eines Menschen verläuft: Wenn die primären Bezugspersonen, meist die Eltern, bei ihren Kindern nicht auf Signale, etwa Schreie, reagieren, könne das Kind nicht lernen, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen. „Dann kann ein Defizit in der Perspektivenübernahme und im Mitgefühl entstehen“, sagt die Psychologin.
Ziel des Forschungsprojekts ist es, gezieltere und wirksamere Therapien für psychisch kranke Straftäter zu entwickeln. „Wenn wir eingrenzen können, in welchem Teilen der Empathie (Mitgefühl, Anm.) gibt es Defizite, dann können wir die Therapien viel genauer entwickeln“, sagt Mier.
ZfP-Direktor Jan Bulla will mit dem Kooperationsprojekt herausfinden, inwieweit sich Empathie wirklich simulieren lässt. „Das ist für den gutachterlichen Bereich enorm wichtig. Kann ein Gutachter erkennen, inwieweit jemand sozial erwünscht oder so antwortet, wie es der Gutachter hören will?“, so Bulla.
100 Euro für Studienteilnehmer
Als Maßstab für Empathie gilt die Allgemeinbevölkerung. Deshalb sollen die Ergebnisse der Untersuchungen bei den psychisch kranken Straftätern einer Kontrollgruppe aus gesunden Menschen gegenübergestellt werden, die in Alter und Bildung zu den Patienten im Maßregelvollzug passen.
Hierfür suchen die Forscher noch Männer und Frauen im Alter von 18 bis 60 Jahren, die über kein Abitur als Schulabschluss verfügen – weil Personen im Maßregelvollzug meist einen geringeren Bildungsgrad haben, sagt Matthias Burghart. Er absolviert mit diesem Forschungsprojekt seine Doktorarbeit an der Uni Konstanz.

Als Belohnung für die Teilnahme an der Studie gibt es eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro pro Person.
Interessierte könnten sich an Matthias Burghart unter der E-Mail-Adresse Matthias.2.Burghart@uni-konstanz.de wenden. Weitere Informationen zur Teilnahme finden Sie hier.





