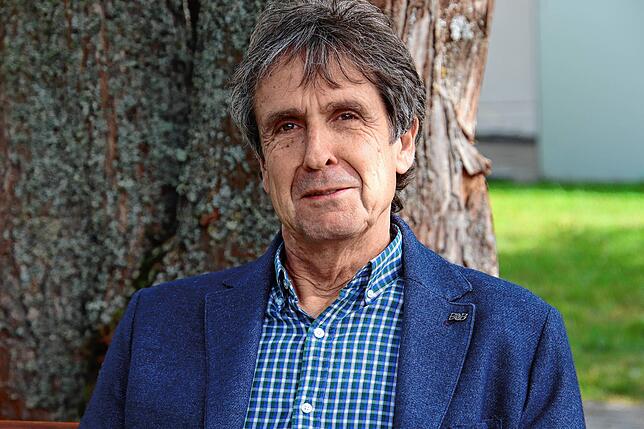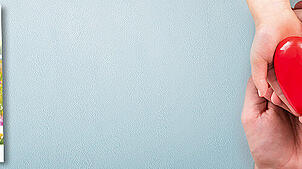Herr Diehl, Corona macht viele Menschen tendenziell einsam. Wie gravierend ist das?
Das ist gravierend. Der Ulmer Psychiater Manfred Spitzer hat ein Buch über Einsamkeit geschrieben, in dem er Einsamkeit als Lebensrisiko Nummer eins bezeichnet. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Krankheit. Wer einsam ist, hat ein deutlich höheres Risiko für Herzinfarkt, Schlafanfall, Demenz oder Krebs. Der Austausch, die Unterstützung fehlt. Einsamkeit bedeutet ja auch, dass keine Berührungen stattfinden.
Gerade Berührung geht im Moment nicht. Was also tun?
Kontakt halten kann man auch, zumindest eine gewisse Zeit, über Skype und Facetime, über Telefon oder E-Mail. Das ersetzt nicht die direkte Begegnung, aber es findet kein Abbruch des Kontakts statt, stattdessen wird er auf anderer Ebene fortgeführt.
Man konzentriert sich aufs Machbare?
Genau. Man kann sich auf einen Kaffee draußen verabreden oder auf eine Kaffeepause bei Facetime. Wir brauchen definitiv andere Möglichkeiten, uns zu treffen, und da müssen wir kreativ sein, damit wir nicht trübsinnig werden. Sonst besteht ein klares Risiko für eine Depression oder eine depressive Phase. Man muss aber auch sagen: Alleinsein ist nicht gleich Einsamkeit. Man kann allein sein, ohne einsam zu sein. Man kann das Alleinsein auch für sich nutzen, zum Beispiel um über sich nachzudenken, um zu reflektieren über die Arbeit. Kann ich die Zeit allein vielleicht für etwas nutzen? Was wollte ich schon immer mal machen? Mich fortbilden, zum Beispiel. So kann das Alleinsein auch eine Chance sein. Das hat definitiv auch gute Seiten.
Auch hier geht es wieder darum, das Positive zu sehen. Ist das überhaupt der Schlüssel zur Bewältigung der Krise?
Wir gucken oft zu sehr auf das Negative, das liegt ein Stück weit auch in der Natur des Menschen. Das war in der Entwicklung des Menschen sinnvoll, weil der frühe Mensch hinter jedem Baum eine Gefahr wittern musste. Das hat sein Überleben gesichert. Und obwohl das heute sicher nicht mehr der Fall ist, fokussieren wir uns unwillkürlich oft auf das, was nicht geht. Es gilt also, sich immer wieder zu fragen: Was geht denn noch? Wer das Gefühl hat, diese Krise zieht ihn runter, dem rate ich dazu erst einmal dafür zu sorgen, dass die Grundbedürfnisse erfüllt werden: Schlafen, Essen, Erholung, genügend Sauerstoff und Bewegung. Die Sinne verwöhnen, schöne Dinge tun.
Das Coronavirus weckt Ängste in vielen Menschen. Was wirkt sich das aus?
Das Wort Angst kommt vom lateinischen angustus – eng. Das macht eng. Wir sind fokussiert auf das, was passieren kann: Wir könnten schwer krank werden. Wir können nicht mehr besucht werden. Die finanzielle Sicherheit ist in Gefahr. Der Mensch hat ein Grundbedürfnis nach Sicherheit, das liegt auch an unserem vegetativen Nervensystem. Der Parasympathikus, der für die Sicherheit, die Geborgenheit und Ausgeglichenheit verantwortlich ist, wird im Moment durch die vielen negativen Nachrichten gar nicht bedient. Das heißt, wir sind in einer Phase der inneren Anspannung. Angst macht handlungsunfähig – wir sind dann wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Die Frage ist also: Was kann ich tun, um wieder etwas Handlungsfähigkeit zurück zu gewinnen? Das geht mit kleinen Schritten: Die Schuhe anziehen, einen Spaziergang machen, ins Handeln kommen. Eines ist sicher: Auch diese Pandemie geht vorbei. Das muss man sich auch gelegentlich klar machen.
Ganz konkret: Wie hält man sich in diesem Winter psychisch fit? Wie kann man einem Winter-Corona-Blues vorbeugen?
Ja, der Winter-Blues trifft in diesem Jahr mit dem Corona-Blues zusammen. Dagegen hilft nur Rausgehen, frische Luft schnappen und Licht tanken. Körperliche Aktivierung hilft gegen die seelische Enge. Wenn man sich bewegt, kommt etwas in Bewegung. Und die Lux-Zahl ist draußen – trotz bedecktem Himmel – um ein Vielfaches höher als drinnen. Bewegung ist das eine. Dann gilt es, die Informationen zu filtern: Einmal am Tag die Nachrichten zu den neuesten Corona-Maßnahmen zu lesen, reicht aus. Ansonsten wird man permanent mit diesen Problemen konfrontiert. Dabei kann man die Sicht auf das Positive verlieren, das es ja trotzdem noch gibt. In der Psychologie spricht man von einem Negativitätsbias – man schaut nur noch auf das, was nicht geht, auf Einschränkungen, auf das, was passieren kann, und verliert den Zugang zu den guten Dingen.
Weihnachten wird nicht so stattfinden wie sonst. Wie kann man daraus etwas Positives ziehen?
Wahrscheinlich wird man im kleinen Familienkreis zusammen feiern. Dass Verwandte quer durch Deutschland fahren und dass man viele Freunde trifft, wird in diesem Jahr vermutlich nicht stattfinden. Aber das kann man auch positiv gestalten. Die Familien können sich Gedanken machen, wie sie Weihnachten verbringen wollen. Man muss auch sehen, dass Weihnachten immer ein großer Stressfaktor ist. Da meint man, Leute einladen zu müssen, die man vielleicht nicht mag. Ein bisschen Alkohol dazu, davor der Einkaufsstress. Das kann jetzt auch eine Chance für ein ruhigeres, besinnlicheres und friedlicheres Weihnachtsfest sein. Aber man sitzt natürlich eng aufeinander. Man wird schon überlegen müssen: Wie gestalten wir das, dass wir gut miteinander auskommen? Spielen kann ein Thema sein. Das ist auch eine Chance für die Familien, enger zusammenzukommen.
Und die Familien, die jetzt schon genug haben voneinander?
Das macht mir Sorge. Vorallem diejenigen, die nicht ausweichen können. Covid polarisiert. Das heißt, bei den Familien und Paaren, bei denen ohnehin eine gute Verbindung besteht, dort wird sie gestärkt. Wo die Verbindung schlecht ist, dürfte das diese Tendenz verstärken.
Manche Eltern sorgen sich um ihre Kinder, weil diese nun in der Schule selbst Maske tragen müssen oder weil sie ständig Menschen mit Maske im Gesicht sehen. Wie sehr schadet Kindern das?
Ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe von Eltern, von Erziehern und von Lehrern ist, dass sie Vorbild sind. Wenn sie den Kindern erklären, dass die Maske eine Maßnahme ist, die uns schützt, und dass das auch wieder vorbeigeht, dann verkraften das die Kinder. Das machen die ganz spielerisch. Man muss nur aufpassen, dass man den eigenen Frust nicht auf die Kinder überträgt.
Was macht die Pandemie mit Kindern? Lockdown, Kontaktverbote, geschlossene Schulen: Was löst das in der Psyche von Kindern und Jugendlichen aus?
In Familien, aber auch in Freundeskreisen treten seit einiger Zeit die Konflikte über den Umgang mit der Pandemie zutage. Spart man das Thema besser aus?
Zum Aussparen würde ich bei echten Corona-Leugnern raten. Denn es ist nicht möglich, mit Corona-Leugnern in eine echte Auseinandersetzung zu kommen. Sie haben keinen Zugang zu den Gefahren, die mit der Krankheit verbunden sind. Für sie ist das eine Grippe, ein Schnupfen. Also in diesem Fall würde ich dazu raten, dieses Thema zu meiden und dem anderen seine Meinung zu lassen. In der Psychologie sagt man: aus dem belasteten Feld gehen.
Gibt es eigentlich eine psychologische Erklärung für die Beliebtheit von Verschwörungstheorien?
Die Corona-Leugner fokussieren sich auf die leichten Verläufe, die es natürlich tatsächlich gibt. Ich glaube, die Sichtweise ist dadurch geprägt, dass die Menschen die schweren Verläufe nicht erlebt haben im nahen Freundes- und Bekanntenkreis. Deshalb werden sie negiert.
Anderes Thema: Werden wir alle zu Menschenfeinden, wo doch der Nächste ein potenzielles Infektionsrisiko ist?
Viele Menschen ziehen sich zurück. Es ist ein Aggressionspotenzial da gegenüber Menschen, die aus Krankheitsgründen keine Maske tragen. Ich habe das kürzlich im Buchladen erlebt. Da hatte ein Kunde ein Attest, dass er keine Maske tragen muss. Was glauben Sie, was da los war! Die anderen Kunden wollten ihn aus dem Laden vertreiben. Die Angst vor der eigenen Ansteckung macht die Menschen aggressiv. Der Ton ist definitiv rauer geworden.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Im Moment irritiert es uns, wenn in Filmen Menschen ohne Maske eng beieinanderstehen. Aber wenn die Pandemie mal überstanden ist, ist zwei Wochen später alles ist wie früher – oder?
Naja, ob da nur zwei Wochen ins Land gehen, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man die Distanz wieder aufgeben wird. Aber ob wir dann gleich wieder Händeschütteln und uns umarmen, das wage ich zu bezweifeln. Bis sich dieser ganz nahe Kontakt wieder einstellen wird, dürfte einige Zeit vergehen. Man muss ja sehen: Das Ganze läuft jetzt acht Monate. Vorsichtig geschätzt wird uns die Pandemie noch das ganze Jahr 2021 begleiten, bis wir einigermaßen durchgeimpft sind. Das heißt, die Pandemie begleitet und prägt uns noch mindestens ein Jahr lang. Aber vielleicht ist das auch okay so, dass wir uns nicht mehr die Hand geben, sondern eine andere Form der Begrüßung nutzen. Vielleicht lehrt uns diese Pandemie aber auch, ein bisschen besser auf den anderen zu achten. Ich bin ein Verfechter davon, dass Krisen auch auch große Chancen sind.
Wie geht es Ihren Covid-Genesenen?
Viele fühlen sich stigmatisiert. Sie machen die Erfahrung, dass das Umfeld Abstand nimmt, weil sie Covid hatten. Obwohl sie nachweislich nicht mehr ansteckend sind. Das passiert sogar hier in der Klinik: Die Covid-Patienten werden teilweise von anderen ausgegrenzt. Was Weihnachten angeht, gehen die Covid-Patienten voller Dankbarkeit, überlebt zu haben, in diese Zeit hinein. Sie genießen das ganz bewusst.
Haben Sie Fragen zu psychologischen Auswirkungen der Pandemie? Wir versuchen diese mit Hilfe von Günter Diehl zu beantworten. Bitte schicken Sie Ihre Fragen per Mail an http://angelika.wohlfrom@suedkurier.de