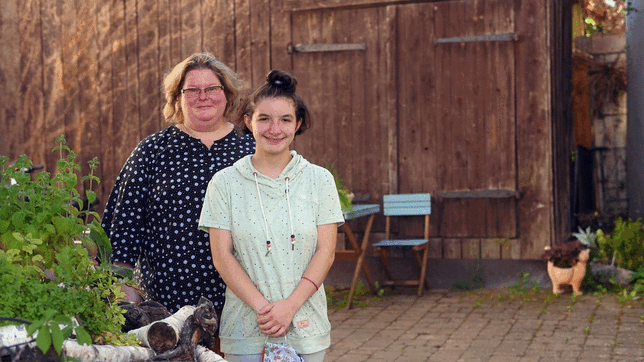Lena Ainser hat Pläne, die für eine 18-Jährige total normal sind: „Ich mag im Herbst den Führerschein anfangen“, sagt sie. Ihr Traumauto hat sie auch schon gefunden: Irgendwann möchte sie einmal einen Mini fahren. Sie lacht und sagt: „Aber erst muss ich versuchen, ob das mit dem Führerschein klappt.“ Wieso daran Zweifel bestehen?
Lena Ainser ist eine junge Frau mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wie es im Fachjargon heißt. Vor Kurzem ist sie ohne regulären Schulabschluss von der Gemeinschaftsschule Salem abgegangen. Sechs Jahre hat sie die besucht, vier Jahre davor die reguläre Grundschule. Dem vorangegangen war ein Vorbereitungsjahr an der Sonnenbergschule in Buggensegel.
„Endlich auf einer normalen Schule!“, beschreibt sie das Gefühl, als sie in die Inklusionsklasse wechseln durfte. Ihre Mutter Silke Ainser beschreibt dieses Ereignis komplett anders: „Ich habe anfangs Rotz und Wasser geheult. Ich hatte Angst, was passiert, wenn sie ihren Schutzraum verlässt.“ Dennoch habe sie sich dann für ihre Tochter für die Inklusionsklasse entschieden, die damals noch komplett neu war. Ob sie dieselbe Entscheidung wieder treffen würde? „Ohne zu zögern und auf jeden Fall. Das war das Beste, was uns passieren konnte!“
Selbstvertrauen und Selbstständigkeit
Ihre Tochter habe dadurch heute besonders großes Selbstvertrauen, das sie anders vielleicht nie hätte gewinnen können. „Und sie hat gelernt, selbstständig zu sein.“ Den Schulweg habe sie mit dem Bus zurückgelegt, so wie andere Jugendliche auch.
Wie ihre Schulzeit war? „Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist und ich Ferien habe“, sagt Lena Ainser und erklärt: „Anstrengend war es. Vor allem am Schluss; da war auch noch Corona.“ Dann zuckt sie mit den Schultern und fügt hinzu: „Aber es war schon auch gut.“
Zu Beginn kaum Leitlinien für inklusiven Unterricht
Daniel Noske ist Sonderpädagoge und hat die Inklusionsklasse die gesamten zehn Jahre lang begleitet, die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sogar elf Jahre betreut. Denn die wurden gleich zweimal eingeschult, wie er erklärt: „Das Vorbereitungsjahr war wichtig für sie, damit der Schritt hinein in die Strukturen einer Regelschule nicht allzu groß ist.“

Die zehn Jahre der Inklusionsklasse beschreibt er als einen Versuch, ein Projekt, ein Herantasten, das seiner Beurteilung nach sehr gut gelungen sei. Als die Idee vor elf Jahren entstanden sei, habe es noch kaum Leitlinien für inklusiven Unterricht gegeben: „Inklusion war da noch vor allem ein Wort auf einem Stückchen Papier.“ So hätte etwa geklärt werden müssen, ob die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf der Regelschule zugeordnet werden würden oder rechtlich eher als Außenklasse des sonderpädagogischen Bildungszentrums fungieren sollten.
Rektor der Sonnenbergschule als Initiator für Inklusionsklasse
Inzwischen sei das eindeutig: Die Schüler der Inklusionsklasse gehören ganz klar zur Gemeinschaftsschule und werden dort auch geführt. „Herr Fordinal stand dennoch die ganze Zeit hinter ihnen, auch wenn sie formal nicht mehr seine Schüler waren“, betont Noske. Günter Fordinal, Rektor der Sonnenbergschule, war überhaupt derjenige, der die Idee zur Inklusionsklasse gehabt hatte und diese an Noske herantrug. In den elf Jahren hat sich einiges verändert: „Es gibt jetzt Eckpunkte, die damals noch gefehlt haben.“
Erfolge machen Pädagogen stolz
Die rechtlichen Hürden beiseite gelassen, blickt der Sonderpädagoge positiv auf die Zeit zurück: „Da tun sich auf einmal so viele Türen auf.“ Er erinnert sich an eine Schülerin mit Förderbedarf, die bis zur siebten Klasse die Fächer Französisch und Englisch auf demselben Niveau belegte wie ihre Mitschüler ohne Förderbedarf. „Das wäre an einer Förderschule nie möglich gewesen“, erklärt Noske, „da hätte man direkt weiter unten angesetzt.“
Inklusionsklassen nicht für alle Kinder gleich gut geeignet
Auch dass eine Schülerin der fünf „Inklusionskinder“, wie sie im Klassenumfeld genannt wurden, eine Anstellung in der freien Wirtschaft bekommen hat, macht ihn sichtlich stolz. Daniel Noske möchte aber gleichzeitig betonen, dass eine Inklusionsklasse nicht für alle Kinder gleich gut geeignet sei. Da müsse man schon genauer hinschauen.
Auch Schulleiterin Bettina Schappeler betont: „Inklusion ist nicht für alle Kinder die beste Lösung.“ Sie halte es für wichtig, genau hinzusehen und die Schüler differenziert zu betrachten. Auch sei es wichtig, dass die Personallage inklusive Projekte überhaupt zulasse. „Wir befinden uns in der luxuriösen Situation, dass Herr Noske mit einer vollen Stelle eine Inklusionsklasse betreuen kann“, schildert sie. Dies sei durch die Kooperation mit der Sonnenbergschule in Buggensegel möglich.
Als aktuelle Schulleiterin der Salemer Gemeinschaftsschule ist Bettina Schappeler sozusagen im Prozess dazugekommen. „Inklusion war für mich nicht neu. An meiner vorherigen Schule gab es Schüler mit chronischen Krankheiten“, erklärt sie.
Erste Veränderungen angedacht
Nach dem Abschluss der ersten Inklusionsklasse an der Gemeinschaftsschule Salem seien nun auch erste Veränderungen angedacht: Die folgenden Inklusionsklassen sollen statt mit Klasse 10 in Klasse 9 bereits enden, da die Erfahrung gezeigt habe, dass das letzte Jahr wenig Raum für Teilhabe biete: „Da stehen einfach die Prüfungen der Regelschüler zu sehr im Fokus.“
Daniel Noske betont zum Schluss: „Es ist wichtig, dass wir als Klassenlehrerteam geschlossen auftreten. Wenn da unterschieden wird, dass die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nur zu mir kommen sollen und die Regelschüler nur zum formalen Klassenlehrer, dann leben wir eine Spaltung vor, die der Inklusion entgegensteht.“
Vom Vorteil, zwei Klassenlehrer zu haben
Benedikt Sorg, der als Regelschüler die Inklusionsklasse besucht hat, bezeichnet die Situation, zwei Klassenlehrer zu haben, als entscheidenden Vorteil: „Das haben auch alle gern genutzt, dass wir zwei Ansprechpartner hatten.“ Manchmal habe die Parallelklasse sie dafür sogar ein bisschen beneidet.

Überhaupt hätten die Vorteile, die sie gegenüber anderen Klassen gehabt hätten, klar überwogen. Der 16-Jährige ist überzeugt, dass eine Gemeinschaftsschule der ideale Ort für Inklusion ist: „Jeder kann an einer Gemeinschaftsschule seinen eigenen Weg gehen und auf seinem eigenen Niveau lernen. Auch die Inklusionskinder können dadurch ihren eigenen Weg gehen.“ So habe man auch die Schwächen der anderen kaum wahrgenommen, denn: „Auf dem Niveau, auf dem jeder arbeitet, ist er ja gut.“
Zuvor in der Grundschule seien die Unterschiede gar nicht ins Gewicht gefallen: „Da ist es ja auch nicht ungewöhnlich, wenn jemand nicht gut lesen kann.“ Nur ganz selten sei es zu Konflikten gekommen: Da hätten Schüler aus anderen Klassen und Stufen die Schüler mit Förderbedarf geärgert oder sich darüber lustig gemacht, wenn sie etwas nicht sofort verstehen konnten: „Da haben wir als Klasse aber dann zusammengehalten und uns darum gekümmert, dass das nicht mehr vorkommt.“
Wie toll der Klassenzusammenhalt gewesen sein muss, weiß auch seine Mutter Christine: „Ich habe eine Erstkommunionsgruppe betreut. In die sind zwei der Mädchen aus Benedikts Klasse gekommen, obwohl sie eigentlich zu einer weiter entfernten Gemeinde gehört haben.“ Die Mädchen hätten sich so wohl in der Gemeinschaft gefühlt, dass sie auch die Kommunion mit ihren Mitschülerinnen gemeinsam erleben wollten.