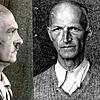Wie geht man mit dem Vermächtnis der NS-Zeit um? Wie bestraft man die Täter auf eine angemessene Art, und wie können Opfer und Täter nach dem Ende des NS-Regimes wieder zusammenleben? Diese Fragen standen im Zentrum eines Vortrags, den der ehemalige Kulturamtsleiter Reinhard Valenta, unterstützt von Liping Li, am Donnerstag im Bürgersaal des Alten Schlosses hielt.
Fatima Zobeidi-Weber, die Leiterin der Volkshochschule (VHS), konnte zahlreiche Besucher bei dem dritten Vortrag im Rahmen der Reihe „Wehr unterm Hakenkreuz“ begrüßen. Der erste Vortrag beschäftigte sich mit der NS-Justiz, der zweite war der Lebensgeschichte Anton Denks gewidmet, im dritten Vortrag ging es um die Entnazifizierung von fünf Wehrer NS-Funktionären. Reinhard Valenta konnte sich auf Quellen aus Frankreich stützen, die bislang noch nicht ausgewertet waren.
Wehr war in den 1930er-Jahren von der Weltwirtschaftskrise schwer getroffen. Bei den letzten demokratischen Kommunalwahlen 1930 gingen fünf der acht Sitze an die katholische Zentrumspartei. Im März 1932 erfolgte die Gründung der NSDAP-Ortsgruppe Wehr, bei den Reichstagswahlen 1933 erhielten die Nazis 37 Prozent der Stimmen in Wehr. Etwa zehn Prozent der 4000 Bürger waren Parteimitglieder. Manche aus Überzeugung, andere, weil sie sonst entlassen worden wären, oder andere Sanktionen hätten erdulden müssen.

Eine zentrale Gestalt war Georg Arnold, der Gründer der NSDAP-Ortsgruppe, der 1934 zum Bürgermeister ernannt wurde. „Er herrschte wie ein kleiner König und etablierte eine Günstlingswirtschaft“, so Valenta. Er war häufig Gast in Kneipen, versäumte Termine, vor allem aber herrschte bei der Ausgabe der Karten für Lebensmittel und andere lebensnotwendige Güter eine hoffnungslose Korruption. Eine Anzeige beim Karlsruher Innenministerium führte zu Arnolds Parteiausschluss.
Aufarbeitung ohne Rachegefühle
Nach dem Krieg war er einer der zehn Funktionäre, die verhaftet und in das Camp Lonzona nach Säckingen gebracht wurden. „Alle wurden als minderbelastet eingestuft, weil sie keine Kriegsverbrechen begangen hatten“, so der Referent. Obwohl Arnold Menschen denunziert, ins Gefängnis gebracht oder für NS-Kritiker Arbeitsverbote erwirkt hatte, gab es auch Menschen, die sich zu seinen Gunsten aussprachen. „Man wollte keine Racheaktionen“, erklärte Valenta.
Arnolds Nachfolger als Ortsgruppenleiter wurde Karl Krafft. Trotz seiner Verstrickungen in das NS-Regime setzte er sich für die Freilassung des Pfarrers von Beuggen aus dem Konzentrationslager Dachau ein. „In totalitären Regimen werden die Begriffe von Gut und Böse manchmal relativ“, so Valenta. Auch Karl Ott, Haupttruppführer der SA, hatte beim Entnazifizierungsprozess einige Fürsprecher: Die Wehrer SPD bescheinigte ihm, er sei „verblendet“ und selbst Opfer der NS-Ideologie gewesen. „Eine typische Täter-Opfer-Umkehr“, so Valenta.
Der Führer der Hitler-Jugend, Gerhard Thiel, erhielt die meisten positiven Gutachten aller verhafteten Funktionäre. Der Tenor lautete: Thiel habe schon in seiner Jugend die Not der Arbeiter gesehen und geglaubt, einer guten Sache zu dienen. Durch Gespräche hatte Reinhard Valenta aber erfahren, dass Thiel Jungen und Mädchen, die nicht zu den Versammlungen der Hitler-Jugend erschienen waren, mit Polizeigewalt herbeischaffen ließ.
Kein einziges positives Zeugnis erhielt hingegen Rudolf Eschbach. Der Kaufmann wurde 1942 bei der Stadtverwaltung angestellt und soll ein fanatischer Nazi gewesen sein. Er war in den Korruptionsskandal bei der Kartenausgabe verwickelt. Obwohl auch er als minderbelastet eingestuft wurde, fasste er in Wehr nie wieder Fuß.
Viele Menschen hätten sich seinerzeit gewünscht, die schreckliche Zeit einfach zu vergessen, beendete Valenta seinen Vortrag.