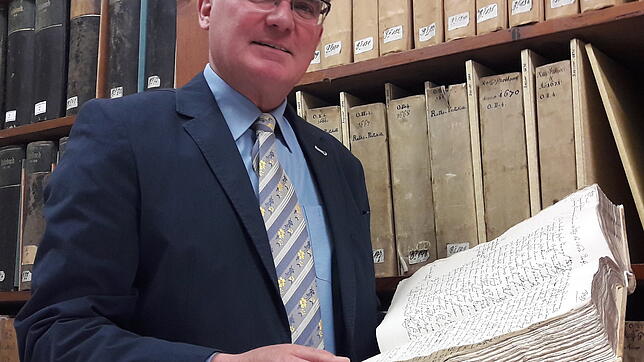Herr Professor Klöckler, warum haben Sie sich mit dem Leben von Willi Hermann beschäftigt?
Sie, Herr Fricker, kamen Ende April auf mich zu mit der Frage, ob in den Beständen des Stadtarchivs Material zu Willi Hermann für eine Festschrift zu finden sei. Hier im Haus ist jedoch kaum etwas über ihn vorhanden. Ich habe daraufhin meine Kollegen im Staatsarchiv Freiburg nach der Entnazifizierungsakte gefragt. Dort ist nur ein Blatt mit dem Vermerk „interniert“ vorhanden. Da war mir klar: Entweder war Willi Hermann in der NSDAP engagiert oder er war an Kriegsverbrechen beteiligt.
Und dann?
Beides hat sich nun bewahrheitet. Ich habe die Entnazifizierungsakte schließlich im Archiv des französischen Außenministeriums aufgespürt und sie in digitaler Form erhalten. Darin fand sich die Angabe von Willi Hermann, er habe beim „Fest.Gren.Blt.909“ gedient. Von da aus war es nur noch ein kurzer Schritt bis Kefalonia, eine griechische Insel, die für jeden Zeithistoriker mit einem der größten Kriegsverbrechen der Deutschen Wehrmacht in Zusammenhang steht.
Fürchten Sie nicht weitreichende Folgen Ihrer Recherche?
Wir leben in Deutschland und speziell hier in Konstanz in demokratisch-freiheitlichen Verhältnissen, in denen es keine historischen Tabus geben darf. Wohin es führt, wenn Gesellschaften bestimmte Epochen ihrer Geschichte nicht erforschen lassen wollen, das können Sie dieser Tage in Russland und in der Türkei beobachten.
Hat Ihnen diese Forschung auch schlaflose Nächte bereitet?
Mich hat vor allem seine Beteiligung an einem der schwersten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs sehr beschäftigt. Ich bin selbst Reserveoffizier der Bundeswehr und hatte in meiner aktiven Dienstzeit die Befehlsgewalt über 30 Panzergrenadiere. Jeder, der einmal Soldat war oder es heute ist, wird sich nach Lektüre des Artikels fragen müssen, wie er in einer solchen Extremsituation gehandelt hätte. Niemand sollte sich mit einer schnellen Antwort zufrieden geben.