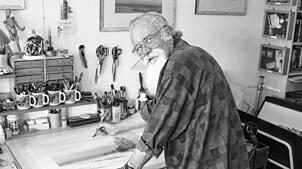Stell' dir vor, es ist Fasnacht – und keiner geht hin. Das ist natürlich nicht so, nicht dieses und nicht kommendes Jahr. Zum Glück, sagen immer weniger. Leider, sagen immer mehr. Kritisch über Fasnacht schreiben? In Konstanz? Im SÜDKURIER? Das ist nicht mutig, das ist blanker Wahnsinn, journalistischer Selbstmord, sagen viele. Warum eigentlich? Wer sich da alles angegriffen fühlen, wem das in den falschen Hals geraten könnte, lauten die Bedenken. Nur derjenige, dem die Fasnacht nicht am Herzen liegt, lautet die Antwort darauf. Wer sie nicht sehenden Auges in die Vergessenheit rennen lassen möchte.
Zwischen Brauchtum und Begleiterscheingung
Die Konstanzer Fasnacht ist Brauchtum pur, ist strählen, schnurren, Karbatschen knallen und Saublottern schleudern; ist Narrenbaumstellen, Wurstschnappen, Sonntagsumzug, Jakobinertribunal; ist vieles mehr, bis sie am Dienstag verbrannt wird. Nur interessiert das immer weniger Menschen. Sie reduzieren die Fasnacht darauf, leidlich verkleidet bereits morgens durch die Altstadt zu schwanken. Unterm Jahr undenkbar, am Schmotzigen Dunschtig aber gesellschaftlich voll akzeptiert. Nun kann man sagen: Das haben die Leute früher genauso gemacht. Das stimmt. Aber die haben das Brauchtum noch gekannt, haben es zumindest nicht als lästige Begleiterscheinung der großen Freiluft-Party gesehen. Leicht lässt sich das auf die stets desinteressierte Jugend von heute schieben. Doch die traditionellen Zünfte und Vereine sind nicht schuldlos. Der Komponist Gustav Mahler schrieb: "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers."
Selbstgenäht oder von der Stange
Warum wird einem denn Tollkühnheit attestiert, wenn man sich womöglich mit der Fasnacht anlegen will – oder besser gesagt mit denen, die sie gestalten? Weil sie wichtig sind, sagt man. Ganz richtig und sie sind es zurecht. Nur lassen sie das ihr Gegenüber auch gerne spüren. Wer das Wissen um die Fasnachtstradition vor sich herträgt wie eine Monstranz, muss sich nicht wundern, wenn ihm die Schäfchen davonlaufen. Es ist recht und billig, sich zu ärgern. Darüber, dass man in sein Häs eine vierstellige Summe und ebenso viele Stunden Arbeitszeit investiert, während Otto-Normal-Mäschgerle das Kostüm von der Stange kauft; auch darüber, dass man sich abmüht, um Schüler aus dem Unterricht zu befreien, während die längst mit Wodka-Schoppen im viel zu knappen Kleid (Mädchen) oder im bemalten Maleranzug mit Schnaps-Klopfern in der Hosentasche (Jungen) mit jeglicher fasnächtlichen Ordnung abgeschlossen haben.
Der Jugend die Tür öffnen
Darüber können traditionsbewusste Fasnachter resigniert mit den Schultern zucken. Sie können sich weiter im Glanz ihrer mit Dutzenden Orden behangenen Saalhemden sonnen. Sie können sich wundern, warum die Häupter bei der Saalfasnacht immer grauer, die Augen immer müder, die Gähner immer herzhafter werden – wo man sich doch wieder kräftig ins Zeug gelegt hat für das viereinhalbstündige Programm. Sie können der Jugend – und fast lächerlich oft immer noch auch Frauen – weiterhin die Tür verrammeln, spätestens wenn es um Positionen des Mitbestimmens geht. Sie können andere Zünfte und Vereine weiter als unliebsame Konkurrenz betrachten, sie können Narrenrätinnen als Untergang des Abendlandes sehen, sie können Zugezogene behandeln wie unliebsame Gäste.
Sie können sich also, wie der Konstanzer sagt, weiter wie die guten alten Großkopferten verhalten. Dann aber werden sie die letzte Generation sein, der die Ideen der Fasnacht etwas bedeuten. Sie verschachern lediglich die von Gustav Mahler beschworene Asche.
Zünfte von morgen denken schon heute
Sie können jedoch auch mit sich selbst ins Gebet gehen, und immer mehr tun das bereits. Zünfte von morgen denken heute darüber nach, ob sie durch die selbst aufgebaute Bedeutung für das Stadtgeschehen bei allem verdienten Stolz nicht doch selbstgefällig geworden sind. Der fasnachtliche Nachwuchs lacht und weint über sekundenkurze Videoclips im Internet, er will nicht eine halbe Stunde lang schunkelnd ihm fremde Narrenlieder absingen. Er ist zum großen Teil nicht einmal in Konstanz geboren. Heimat ist kein Ort für ihn, sondern ein Gefühl, das ständig anderswo verortet wird. Die Traditionalisten werden sich strecken müssen, um dieses Gefühl zumindest für einige Tage auf die Gass' zu lenken. Aber nicht mit elitärer Hand, sondern mit offenem Ohr.
Was den Bürgern gefällt
Das muss und darf nicht heißen, dass traditionelle Bräuche, auch Regeln, über Bord gehen müssen. Weiße Turnschuhe im Häs sehen blöd aus; Alaaf und Helau klingt für unsere Ohren nicht gut; und Rasierschaum gehört ins Badezimmer, nicht auf den Hemdglonkerumzug. Zur Konstanzer Fasnacht hat aber immer auch die Vielfalt gehört, und den Bürgern gefällt das. Sie zelebrieren das, gründen im besten Fall neue Gruppen mit oft gelungenen Masken und Häsern. Sie nehmen Mahlers Feuer auf.
Warum dieses Essay entstanden ist
- Der Anlass: Immer mehr Konstanzer Zünfte beklagen den fehlenden Nachwuchs. Gleichzeitig ist die Begeisterung für die Fasnacht in der Stadt groß, tausende sind auch an diesem Schmotzigen Dunschtig durch die Gassen gezogen. Der Sinn für Tradition und Brauchtum geht allerdings verloren.
- Der Autor: Benjamin Brumm ist die Fasnacht wichtig. Sein erstes "Narro Narro siebe siebe" hat er – weil er sehr faul war – gerufen, noch bevor er seine ersten Schritte ging. Als gebürtigem Konstanzer würde ihm ohne die närrische Zeit etwas fehlen.
- Die Sorge: Seit dem 13. Jahrhundert soll es die Fasnacht in Konstanz mindestens schon geben. Seither durchlief sie mehrere Krisen, wurde zigfach verboten – und überlebte dennoch. Damit auch im 22. Jahrhundert noch Ho Narro gerufen wird, müssen sich auch die Zünfte öffnen.