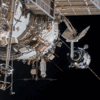Viele Besitzer von Freigänger-Katzen kennen es. Kaum ist die Tür geschlossen, beginnt für die Katze ein anderes Leben, von dem kaum jemand etwas weiß. Es kann passieren, dass der Stubentiger über mehrere Tage nicht nach Hause kommt. Man fragt sich nicht selten: Wo ist das geliebte Haustier und was macht es eigentlich da draußen?
Antworten soll ein Projekt des Max-Planck-Instituts (MPI) für Verhaltensforschung liefern. Gemeinsam mit der Universität Konstanz haben Forscher einen Sender entwickelt, der nicht nur Erkenntnisse darüber liefern soll, wo sich eine Katze bewegt, sondern auch darüber, wie sich das Tier verhält.
Daten sollen künftig verhindern, dass Katzen Vögel jagen
Wie ein kleiner Rucksack sitzt der Sender auf dem Rücken der Katze. Die Daten sammelt und übermittelt eine künstliche Intelligenz, die darin eingebaut ist. An Entwicklung und Bau der intelligenten Sensoren waren unter anderem Studenten und Mitarbeiter der Universität Konstanz beteiligt.
Die gelieferten Daten lassen Rückschlüsse über das Verhalten des Tieres zu und sollen so künftig für mehr Artenschutz sorgen können. „Wenn eine Katze einen Vogel jagt, bewegt und verhält sie sich anders, als wenn sie beispielsweise eine Maus erlegt“, weiß Martin Wikelski, Leiter des MPI für Verhaltensforschung.

Das erkenne auch der Sensor. Wenn die Wissenschaftler verstehen, was den Jagdtrieb der Katze auslöst, könne man diesem Verhalten dann beispielsweise durch einen Chip gegensteuern.
Forschung für Artenschutz
Was nach Verhaltenskontrolle klingt, soll aber das Artensterben stoppen. Denn oft seien Katzen verantwortlich dafür, dass Vogelarten dezimiert werden. Kann man sie daran hindern, Vögel zu jagen, bedeutet das: Artenschutz.
Doch nicht nur das ist das Ziel von Wikelski und seinem Team. Denn für viele Menschen seien Forschung und künstliche Intelligenz zu weit weg von der eigenen Lebenswelt. Deswegen versuchen die Forscher nun mithilfe des Katzen-Projekts mehr Verständnis für derlei Themen zu schaffen, indem Außenstehende miteingebunden werden – unter anderem auch Schüler.
Katzenbesitzer lernen ihre Tiere besser kennen
Durch eine App könnten Katzenbesitzer, die sich an dem Projekt beteiligen wollen, das Verhalten ihres Tieres selbst beobachten. Bei dem Projekt mitzumachen, ist bis dato allerdings nicht so einfach: Denn ein Mitarbeiter des MPI muss den Sender selbst an der Katze anbringen, so Wikelski. Das soll sich aber künftig ändern, sodass möglichst viele Katzenbesitzer sich an dem Projekt beteiligen und sich selbst an der Wissenschaft probieren können.
Gefördert wird das Projekt seit Dezember 2019 von der Baden-Württemberg-Stiftung mit einer Viertel Million Euro. Nese Erikli, Landtagsabgeordnete der Grünen für den Wahlkreis sowie Mitglied des Aufsichtsrats der BW-Stiftung hatte sich dafür eingesetzt, das Projekt realisieren zu können, sagt sie. für den Forschungsstandort sei das viel Geld. „Das ist ein tolles Forschungsprojekt, das mussten wir unterstützen.“
Was Wikelski und sein Team mit dem Katzen-Projekt verdeutlichen wollen, hat in Wirklichkeit jedoch ganz andere Dimensionen. Denn weltweit wurden schon etliche Wildtiere mit einem ähnlichen Sender ausgestattet. Darunter sogar Insekten, wie Schmetterlinge.

Ein Satellit mit dem Namen Icarus, der der Raumstation ISS angedockt ist, sammelt und speichert diese Unmengen von Daten, die von Tieren auf der ganzen Welt generiert werden. „Das ist das Internet der Tiere“, so Wikelski, nirgendwo sonst gebe es eine solch große Datenbank an Tierdaten, so der Wissenschaftler weiter.
Katastrophen durch Tiere vermeiden
Online sind diese Daten abrufbar. Realisiert wurde dieses Projekt zu großen Teilen in Konstanz. Ziel der Forschung soll es sein, beispielsweise herauszufinden, wie sich Tiere in bestimmten Situationen verhalten, daraus zu lernen und Erkenntnisse für die Menschheit abzuleiten.
Beispielsweise will das Forscherteam herausfinden, wie sich über Tiere eine Pandemie verbreitet oder, wie das Warnsystem der Tiere bei Umweltkatastrophen funktioniert. Man wisse, so Wikelski, dass beispielsweise Ziegen, die an einem Vulkan grasen, bereits vor einem Ausbruch wissen, dass es zu einer Katastrophe kommt und frühzeitig fliehen. Das wolle man sich zunutze machen.