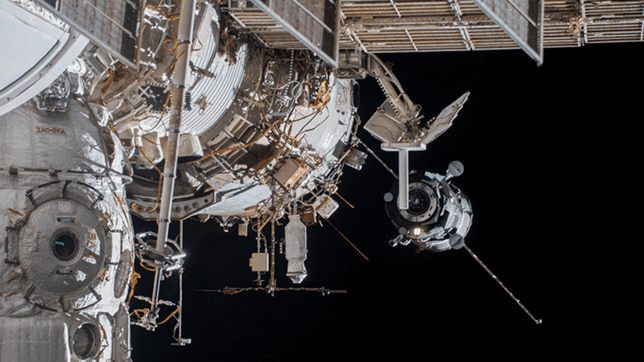Der Moment, in dem sich Vision und Lebenswerk von Martin Wikelski erfüllen, könnte kaum nervenaufreibender sein.
Der Direktor vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie steht in einem kargen Konferenzraum, um ihn herum Wissenschaftler, Ingenieure und Journalisten.
Beide Arme auf den Tisch gestützt blickt der 54-Jährige angespannt auf ein Telefon.
Über den Lautsprecher klingt eine Stimme mit russischem Akzent: „Icarus funktioniert normal.“ Für einen Augenblick herrscht Stille, dann klatscht Martin Wikelski in die Hände und umarmt lachend seine Kollegen.
Zwei Jahrzehnte harte Arbeit, Rückschläge und Zweifel: Das alles ist jetzt Vergangenheit. Seine Vision ist Wirklichkeit geworden.
Icarus, das deutsch-russische Projekt zur Beobachtung von Tierbewegungen aus dem Weltall, ist gestartet.
Großer Schritt für das Verständnis der Lebenszusammenhänge
Eigentlich sollte der russische Kollege den Start von Icarus gemeinsam mit Martin Wikelsi feiern, hier in der Zentrale des Technologiepartners Space Tech in Immenstaad. Doch das Coronavirus macht dem Icarus-Team einen Strich durch die Rechnung.
Die Stimmung vor Ort ist trotzdem ausgelassen: Einige Umarmungen, ein Glas Sekt und ein Fernsehinterview später hat der Biologe sein Grinsen noch immer nicht verloren. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen“, sagt er.
„Wir sind gerade einen großen Schritt dabei gegangen, das Tierleben auf unserem Planeten zu verstehen, davon konnte Alexander von Humboldt nur träumen.“
Tatsächlich könnte Icarus eine neue Ära im Verständnis der Lebenszusammenhänge auf der Erde einläuten, das Versprechen ist einmalig: Die Wanderung von Tieren wird mit Hilfe der Internationalen Raumstation ISS aus dem All beobachtet werden. Dies soll künftig nicht nur dem Artenschutz dienen, sondern auch Menschenleben retten.
Diese Organisationen sind am Projekt beteiligt:
Für Icarus werden Tiere wie Zugvögel, Fische und Ziegen mit kleinen Peilsendern ausgestattet. Die ISS greift sich die Informationen aus etwa 400 Kilometern Höhe. Dann werden die Daten zurück auf die Erde geschickt und Forschern weltweit zur Verfügung gestellt.
Die leichten Hightech-Sender liefern neben der Position eines Tieres auch weitere Daten wie Beschleunigung und Temperatur. Sie sind gerade einmal so groß wie ein Daumen und werden mit Solarenergie betrieben.
Zehntausende Tiere sollen mit Sendern gepeilt werden
Über einen Zeitraum von bis zu vier Monaten wollen die Forscher zunächst das Zusammenspiel zwischen Raumstation, Tier-Sendern und Bodenstation testen. Nach Abschluss dieser Phase sollen mehrere Tausend Tiere verdrahtet werden.
International Cooperation for Animal Research Using Space, dafür steht Icarus. An dem Projekt sind unter anderem die russische Weltraumorganisation Roskosmos und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) beteiligt.
Der Technologiespezialist Space Tech aus Immenstaad am Bodensee liefert das Herzstück von Icarus: die Antenne. Im vorigen August wurde das teure Spezialgerät bei einem Außenbordeinsatz am russischen Segment der ISS installiert.
Die Idee für das Icarus-Projekt kam Martin Wikelski vor beinahe 20 Jahren, bei einem bierseligen Abend auf einer Forschungsreise in Panama, wie sich der Biologe erinnert.
In einer Vollmondnacht beobachten er und ein Freund Fledermäuse auf der Jagd nach Insekten. Da kommt ihnen der Gedanke, dass sich Tiere auch aus dem All beobachten lassen könnten. Noch in der selben Nacht schreiben sie ihre Vision mit einem Bleistift auf einen Briefumschlag.
Von der Vision zur Wirklichkeit ist es ein steiniger Weg: Wikelski stellt seine Idee zunächst der US-Raumfahrtbehörde Nasa vor – die lehnt ab. Es bleibt nicht der einzige Rückschlag. Heute ist Icarus eine Erfolgsgeschichte: Weltweit arbeiten mehr als 100 Menschen an dem Forschungsprojekt, eine davon ist Elizabeth Yohannes.
Intelligenz der Tiere könnte Katastrophen vorhersagen
Die 48-Jährige koordiniert die Icarus-Partner in der ganzen Welt, mehr als 300 Projekte sind bereits in Planung. Seit zwei Jahrzehnten arbeitet sie im deutschsprachigen Raum, seit zwei Jahren ist sie im Icarus-Team um Martin Wikelski.
Die Ornithologin ist überzeugt, dass Icarus einmalige Erkenntnismöglichkeiten bietet. Zum einen könnte die Tierbeobachtung aus dem All unser Verständnis von der Klimakrise erweitern und zum Artenschutz beitragen, etwa indem Schutzzonen angepasst und verbessert werden, erklärt Elizabeth Yohannes.
Von den Tier-Daten sollen in Zukunft auch Menschen profitieren: Icarus könnte als Frühwarnsystem für Erdbeben und Vulkanausbrüche dienen. In der Vergangenheit verhielten sich Tiere bei Naturkatastrophen auffällig, etwa Ziegen bei einem Ausbruch des Ätna auf Sizilien.
Zudem könnte Icarus dabei helfen, die Verbreitung von Krankheitserregern durch Tierwanderungen vorherzusagen und schneller einzudämmen. „Das Coronavirus ist ein gutes Beispiel“, sagt Elizabeth Yohannes.
„Ein genaueres Wissen über die Routen von Enten zum Beispiel könnte uns in Zukunft dabei helfen, der Verbreitung von Grippeviren vorzubeugen“, erklärt die Wissenschaftlerin, die in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, aufgewachsen ist.
Icarus sei ein wissenschaftlicher Quantensprung, sagen Elizabeth Yohannes und Martin Wikelski einstimmig. Erstmals könne die Intelligenz der Tiere für das Zusammenleben auf diesem Planeten nutzbar gemacht werden. Das „Internet der Tiere“, wie beide Icarus gerne nennen, sei zum Greifen nah.