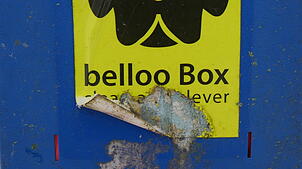Was wäre unsere Gesellschaft ohne Vereine? Diese Frage hat der SÜDKURIER ganz am Anfang der elfteiligen Serie „Dein Verein, unser Thema“ aufgeworfen. Und die Antworten, die Kollegen der Lokalredaktionen Singen/Hegau, Radolfzell und Stockach zusammengetragen haben, ergeben ein ziemlich eindeutiges Bild.
Unser Leben wäre viel langweiliger, stiller, wir säßen viel mehr zu Hause rum, wir wären weniger sportlich, nicht so gesund, nicht so glücklich, hätten alle weniger Freunde und Bekannte, hätten weniger Talente und Fähigkeiten, würden weniger sehen und erleben, kurz: Unsere Gesellschaft wäre nicht die selbe. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, sie wäre ohne Vereine durchaus schlechter dran.
Vereine prägen die Gesellschaft demokratisch
Vereine sind auch ein Indikator dafür, wie demokratisch eine Gesellschaft ist. Maria Fülberth ist Leiterin des Projektes „Demokratie leben“ bei der Volkshochschule Landkreis Konstanz und arbeitet eng mit der Stadt Radolfzell zusammen. „Vereine haben demokratische Strukturen. Gibt es an einem Ort viele Vereine, ist das ein Hinweis darauf, dass die Gesellschaft selbst demokratisch veranlagt ist und sich auch so im Privatleben verhält“, erklärt sie.
In einem Verein müssten sich Menschen auf freiwilliger Basis organisieren, um Veranstaltungen zu stemmen. Dies gehe nur mit Zusammenarbeit, Absprache und Diskussionen und zeige, wie bereit Menschen grundsätzlich dazu sind.
Engagement hat eher zugenommen über die Jahre
Und das freiwillige Engagement in Deutschland ist laut einer Studie aus dem Jahr 2019 des Bundesministeriums für Familie stabil auf einem hohen Niveau. Der Anteil freiwillig engagierter Menschen ist in den vergangenen 20 Jahren gestiegen, zeigen die Ergebnisse des fünften Deutschen Freiwilligensurveys. Im Jahr 2019 übten 39,7 Prozent der Personen ab 14 Jahren in Deutschland eine freiwillige Tätigkeit aus. Im Jahr 1999 waren es 30,9 Prozent.
Michaela Horn ist beim Verein Deutsches Ehrenamt mit Sitz in Herrischried als Beraterin für Vorstände tätig. Sie sieht keinen Nachwuchsmangel in deutschen Vereinen. „Junge Menschen in der Altersgruppe 14 bis 29 Jahre engagieren sich – allen Unkenrufen zum Trotz – mit 42 Prozent durchaus häufig freiwillig“, erklärt sie auf Nachfrage des SÜDKURIER.
Drei große Herausforderungen der Zukunft für Vereine
Mehr Konkurrenz für den klassischen Dorfverein
Beschreibungen, dass es Vereinen immer schwerer falle, junge Menschen langfristig zu binden oder dass Jugendliche sich weniger engagieren würden, kann Horn aus ihrer Beratertätigkeit nicht bestätigen. Eine Erklärung, warum es manchen Vereinen, vor allem in ländlichen Regionen, dennoch so gehe, sieht sie in der Konkurrenzsituation für den „klassischen Dorfverein“. Junge Menschen würden sich zwar grundsätzlich mehr ehrenamtlich engagieren, aber die Möglichkeiten dazu seien ebenfalls vielfältiger geworden. „In unserer Praxis sehen wir das vor allem in den Bereichen Engagement für Geflüchtete und Naturschutz“, so Horn.
Einer, der sich in einem Verein auch im Vorstand engagieren möchte, ist Kai Eberhard. Der gebürtige Radolfzeller studiert an der Fachhochschule in Konstanz BWL und ist seit Kurzem Vorstandsmitglied in der Zeller Kultur. Warum sich der 20-Jährige gerade in einem lokalen Kultur-Verein engagiert? „Dieser Verein ist nicht selbstverständlich. Wenn ich dazu beitragen kann, das Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger zu erhalten, dann mache ich das gerne“, erklärt Kai Eberhard.
Zeller Kultur möchte sich digital neu aufstellen
In die Zeller Kultur kam er als Kind über die Kindertheatergruppe und blieb dort, bis er zu alt für das Ensemble wurde. Dann gründete er mit anderen die Jugendtheatergruppe, in der er auch noch aktiv ist. Und nun möchte er im Vorstand der Zeller Kultur helfen, das Angebot zum einen digital besser zu präsentieren und gleichzeitig neue Formate für ein jüngeres Publikum zu erarbeiten.
„Die anderen Vorstandsmitglieder sind sehr offen und dankbar für Ideen und ich habe die Möglichkeit mich hier einzubringen und mitzugestalten“, sagt der Student. Ein erstes Projekt hat er schon: Zwischen den Jahren soll es in der Zeller Kultur eine Art Escape-Spiel geben, ähnlich einem Escape Room, bei dem die Besucher Rätsel lösen müssen und so Punkte sammeln können.
Der Generationenwechsel im Vorstand der Zeller Kultur ist nun erfolgreich eingeläutet. So einfach gelingt es allerdings nicht allen Vereinen, für jungen Nachwuchs im Vorstand zu sorgen. „Beim Thema Generationswechsel kennen wir leider kein Patentrezept“, sagt Michaela Horn vom Verein Deutsches Ehrenamt.
Sie erkläre die Thematik gerne mit dem Bild des „Lebenszyklus eines Vorstandes“: Viele Vorstände, vor allem in ländlichen Regionen, kämen schon als Kind oder Jugendlicher in den Verein. Als Erwachsener blieben viele, zum Teil mit Unterbrechungen während der Ausbildungszeit, dem Verein treu. Und dann irgendwann seien sie bereit, einen Vorstandsposten zu übernehmen. „Das soll völlig ohne Pathos bedeuten: Die Kinder von heute sind die Vorstände von morgen“, fasst Horn zusammen.
Jeder Vorstand hat einen Lebenszyklus
Vereine seien also gefragt, an allen Stellen dieses Lebenszyklus zu arbeiten, um junge Menschen für den Verein und letztlich auch für die Übernahme von Verantwortung zu begeistern. Dies sei sicher für den einen Verein leichter als für den anderen. Aber Michaela Horn betont: „Die Bereitschaft für das Engagement ist da, das Problem ist also lösbar.“
Da Vorstandsarbeit nicht erst heute, sondern schon immer komplex war, sei ein Weg laut Michaela Horn die Wissensvermittlung und Kompetenzerweiterung. Auch junge Leute sollten in die Verantwortung genommen werden, auch dies sei eine Möglichkeit, sie an den Verein zu binden.
Bei allen komplizierteren Themen wie beispielsweise Recht, empfiehlt Michaela Horn, sich Fachberatung einzuholen. So könne ein Vorstand sein persönliches Risiko reduzieren. „Das ist eine große Aufgabe und typischerweise mit viel Arbeit verbunden, aber – und da sind sich die meisten Menschen im Land einig – es ist notwendig und lohnt sich“, sagt die Vorstandsberaterin.