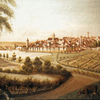Menschen müssen einmal sterben. Daran führt kein Weg vorbei. Die Riten, die zu einer Beerdigung gehören, haben sich im Laufe der Zeit verändert – und ebenso die Friedhöfe in der Linzgaustadt.
Der Begriff leitet sich ursprünglich vom althochdeutschen „frithof“ ab. Und das war die Bezeichnung für den eingefriedeten Bereich um eine Kirche. Und genau da wurden die Menschen auch in Pfullendorf zur letzten Ruhe gebettet. Die Grünfläche bei der Jakobuskirche war der ursprüngliche Friedhof – und das vermutlich schon vor der Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1220. Gräber gab es aber auch rund um das Gotteshaus. Gegenüber des Kirchturms soll eine dem heiligen Michael geweihte Kapelle gestanden haben, die auch als Beinhaus diente. Dort wurden dann die Gebeine der Toten aufbewahrt, die zu früh umgebettet werden mussten, weil der Friedhof zu klein war.
Nach der Verlegung des Friedhofs blieb die Kapelle bestehen. Nach 1600 wurden dort nicht nur die Totenbahre, sondern auch der Palmesel untergebracht. Im Volksmund nannte man das kleine Kirchlein deshalb auch „Eselstall“. Als man im Jahr 1880 die Waschküche des Hotels „Schwanen“ (heute Café „Moccafloor“) gebaut hat, da wurde die Kapelle abgerissen. Fünf Wagenladungen voller Gebeine sollen abtransportiert worden sein, wie man nachlesen kann.
Zuwenig Platz für die Toten
Schon ein flüchtiger Blick macht deutlich, dass der Platz schon sehr begrenzt war. Vor allem nach der Pest platzte der Gottesacker förmlich aus allen Nähten. So starben in den letzten vier Monaten des Jahres 1628 etwa 555 Menschen an der tückischen Seuche. Bürgermeister und Rat der Reichsstadt sannen auf eine Lösung des Problems. Dabei hatten sie nicht nur den Platzmangel im Blick, sondern auch eine mögliche Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung. Die Mediziner des Mittelalters gingen davon aus, dass sich im Erdreich schädliche Dämpfe entwickeln und diese dann aus dem Boden aufsteigen und Krankheiten verursachen. Verwesende Tote galten als besonders schädlich und sollten aus dem Stadtgebiet entfernt werden.

Das wurde in Pfullendorf dann auch so gemacht. Der Friedhof wurde einem bereits bestehenden Gräberfeld bei St. Katharinen angegliedert. Dort wurden bereits die Leprosen bestattet. Dabei handelte es ich um vom Aussatz befallene Menschen, die das Stadtgebiet nicht betreten durften und im so genannten „Leprosenhaus“ betreut wurden. Später stand an dieser Stelle die Wirtschaft „Deutsches Haus“, in der heute ein Spielautomatensalon untergebracht ist. Die Kapelle ist längst abgerissen worden. Nur noch ein Straßenname erinnert an das kleine Gotteshaus.
Probleme mit neuem Friedhof
Der neue Friedhof bot außerhalb der Enge der von einer großen Mauer umgebenen Stadt viel Platz. Aber es gab trotzdem Probleme. Wegen der nahen Weiher war der Boden sehr feucht und zudem durfte jeder Bewohner des Leprosenhauses zehn Hühner halten, die dann auch teilweise auf dem Friedhof unterwegs waren. Also machten sich die Stadtoberen wieder auf die Suche nach einem geeigneten Platz. Fündig wurden sie bei der Kapelle St. Leonhard, die schon vor dem Jahr 1400 erbaut worden war. Das erste Begräbnis fand an Maria Himmelfahrt im Jahr 1551 statt.

Erst im Jahr 1816 wurde der St.-Katharinen-Friedhof endgültig geschlossen. Man hatte dort auch nach 1551 immer mal wieder jemanden beerdigt, aber das waren vorwiegend Menschen, deren Lebenswandel nicht gerade christlich war. So im Jahr 1780 einen Räuber, den man wegen eines Einbruchs im Pfarrhaus in Zell a.A. hatte köpfen lassen. Verbrecher, Selbstmörder und andere Menschen, die nicht den moralischen Grundsätzen der damaligen Bevölkerung entsprachen, durften auf dem neuen Friedhof nicht beerdigt werden.
Da die Bevölkerung ständig zunahm, gab es auch mehr Beerdigungen. Und so wurde die Kapelle St. Leonhard, die nun Friedhofskapelle war, deutlich zu klein für die Seelenmessen. Bereits im Jahr 1555 soll man sie um eine Vorhalle erweitert haben. Im Nachhinein dürfte sich die Verlegung des Friedhofs aus einem traurigen Anlass als sinnvoll erwiesen haben. Bei er letzten Pest in Pfullendorf im Jahr 1628 wurden sehr viele Stadtbewohner von der Seuche hingerafft.

Ältestes Grabmal aus dem Jahr 1566
Noch heute ist der alte Friedhof, auf dem noch sehenswerte alte Grabsteine zu finden sind, ein ganz besonderer Ort. In der nördlichen Außenmauer sind Relieftafeln eingelassen, die Reste von Grabstätten, die sich einmal hier befanden. Das älteste noch erhaltende Grabmal stammt aus dem Jahr 1566 ist aber sehr verwittert, sodass die Jahreszahl nicht mehr erkennbar ist. Sehenswert sind auch die Grabstätten berühmter Bürgersfamilien auf dem mittleren Friedhof, der sich zwischen der alten Anlage aus dem Jahr 1551 und dem 1912 angelegten Gräberfeld befindet. Der „neue Friedhof“ ist als eine Art Park gestaltet. An der Nordmauer wurde eine Leichenhalle gebaut, die 1975 vollständig abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt wurde. Urnengräber sind mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich.