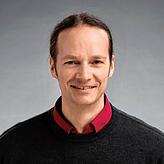Die Nachrichten in Zeitung und Fernsehen sind wegen Corona voller negativen Meldungen: Infektionszahlen steigen an, Unternehmen bauen Arbeitsplätze ab und auch das Feiern ist in diesen Zeiten unmöglich. Möglicherweise kann man zudem zahlreiche Bekannte und Verwandte aus einer anderen Stadt nicht besuchen. Und an das ferne Reisen ist nicht zu denken – um die Gesellschaft vor dem Virus zu schützen. Doch was machen die Corona-Pandemie und sämtliche Maßnahmen, welche dieses eindämmen sollen, mit unserer Psyche?
Die Psyche sei ein komplexes und schwieriges Thema, da könne man nicht pauschalisieren, sagt Matthias Holzapfel. Doch die Corona-Situation mache Patienten sehr zu schaffen, so der Leitende Psychologe der Mediclin in Donaueschingen. „Die Patienten haben zwar mehr Sorgen bezüglich des Virus, aber in der Klinik haben wir keinen Anstieg an Virusphobien“, sagt er.
Schlimmer seien aber die soziale Isolation und der Lockdown, denn der fehlende Kontakt mit Menschen verschlimmere die psychische Situation vieler Patienten. Während einer Depression haben die Menschen zwar kaum Antrieb und Energie, „aber das ist ein Trugschluss dem nachzugehen, denn von nichts machen wird die Krankheit nicht besser“, sagt er.
Eigene Gefühlswelt ist entscheidend
Glücklicherweise sei die Klinik aber „voller Leben“, denn Sport und Gemeinschaft seien unter Einhaltung der Hygieneregeln weiterhin möglich. „Diese Unternehmungen sind wichtig für die Patienten, denn es ist eine Ablenkung zu all den negativen Gedanken“, erklärt er. Man habe mehr Zeit in negative Denkspiralen abzurutschen. Menschen mit gesunder Psyche könnten das wegstecken, aber für Menschen mit einer anfälligen Psyche und Krankheitstendenzen sei es wie ein Nährboden für Erkrankungen.
Die Negativität rund um das Virus könne die Psyche in die Knie zwingen, sagt der Psychologe. „Erkrankte nehmen eine Alles-oder-Nichts-Haltung ein, aber es ist wichtig zu wissen, was man trotzdem unternehmen kann“, so Holzapfel. Deswegen sollen alle Menschen aktiv bleiben und „etwas tun“: spazieren in der Natur sowie sozialen Kontakten nachgehen, sofern es die Corona-Maßnahmen zulassen. Insbesondere, da Schule oder Arbeit von Zuhause auf Dauer keine einfache Situation sei: „Man sollte ein Augenmerk auf anfällige Menschen und insbesondere Kinder legen“, sagt Holzapfel.

Ob es während der Corona-Zeit mehr psychische Erkrankungen wie Depressionen gibt? Das könne man laut Holzapfel so nicht sagen, denn die Mediclin beherberge aktuell nicht mehr Menschen als sonst. „Ich kann auch keine Prognose wagen. Das wird sich rückwirkend zeigen, ob es mehr Krankheitsbilder gibt“, sagt Holzapfel.
Schwierigkeiten im Alltag
„Der erste Lockdown war eine Katastrophe für unsere Patienten“, sagt Jasmin Frank. Denn die diakonische Tagesstätte „Die Brücke“ für chronisch Erkrankte sei „von heute auf morgen zu gewesen“, sagt sie. „Für die Patienten ist es im Augenblick schwieriger, den Alltag zu meistern“, denn der Austausch und der soziale Kontakt seien essenziell für die Erkrankten. Viele Patienten würden deswegen mehr Medikamente zu sich nehmen. Im November kann „Die Brücke“ mit Hygieneregeln geöffnet sein, sagt Frank. Für die Menschen sei es wichtig zu wissen, dass jemand für sie da ist, denn Ungewissheit und fehlende Tagesstrukturen verschärfen die psychische Situation vieler.
Außerdem leiden viele Menschen während des Lockdowns an Vereinsamung, deswegen seien die Patienten dankbar, dass sie einen Ansprechpartner und einen geschützten Rahmen haben, sagt Frank. Denn Beratungen über Telefon und Internet seien schwierig und unpersönlicher. Doch nicht nur für Gefährdete und Menschen mit einer Grunderkrankung sei die Zeit herausfordernd: „Es ist für alle schwer greifbar.“ Auch sie ist der Meinung, Strukturen, Aktivität, sozialer Austausch und frische Luft seien in der aktuellen Lage ratsam. Frank hingegen habe gehört, dass die Zahl der Depressionen steigt: „Die Brücke“ habe bereits drei Neu-Anfragen seit den Corona-Verschärfungen.
„Menschen sind unterschiedlich und so gehen sie auch mit Corona und den verbundenen Maßnahmen um“, sagt Tina Eckerle. Deswegen seien pauschale Antworten bei diesem komplexen Thema unmöglich, so die Schulsozialarbeiterin. Dies sei auch während des Lockdowns so: manche Schüler seien über die Schließung der Sportstudios traurig, andere würden Alternativen suchen und sich im Freien sportlich betätigen. Entscheidend sei es, sagt Eckerle, wie man mit der Situation umgeht: „Menschen, denen es vor Corona schon nicht gut ging, wird es nun unter Umständen noch schlechter gehen. Andere werden auch dieser Phase etwas Positives abgewinnen können.“
Zwar sei auch der Fernunterricht keine einfache Situation; vielen Schülern falle es schwer, dennoch komme damit auch ein Teil der Schüler gut zurecht. Laut Eckerle sind Senioren und Kleinkinder ziemlich von den Einschränkungen betroffen: „Kleinkinder verstehen eher noch nicht so gut, warum Dinge sich verändern. Senioren haben meiner Ansicht nach am ehesten unter Kontaktbeschränkungen zu leiden.“ Denn diese Altersgruppe sei womöglich noch nicht vollständig im digitalen Zeitalter angekommen, wodurch Jugendliche einen deutlichen Vorteil durch die Nutzung der sozialen Medien haben, sagt die Schulsozialarbeiterin. Die Folgen von Corona würden sich unter Umständen, so Eckerle, nicht unmittelbar jetzt abzeichnen: „Es werden aber Spätfolgen auftreten, denen wir uns stellen müssen, wie etwa Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden.“