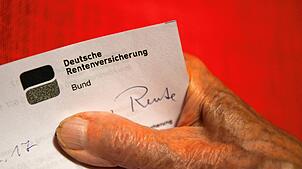Anfang März gab es im Gebiet Kälberwaid eine Probebohrung. Bis es dazu kam, war allerdings einige Geduld gefragt. Bürgermeister Rudolf Fluck machte seinem Unmut bei der jüngsten Sitzung Luft: „Es macht mich traurig, dass das Landratsamt sechs Wochen braucht, um mit einer einfachen Unterschrift die Bohrgenehmigung zu erteilen, weil Mitarbeiter aus der zuständigen Abteilung einfach abgezogen werden.“ Letztendlich konnte die 200 Meter tiefe Bohrung dann aber erfolgen. Die anschließende Untersuchung in Form eines „Thermal Response Tests“, bei dem die mögliche Entzugsleistung der Wärme aus dem Boden untersucht wurde, bestätigte den vorhergesagten Erfolg.
Harald Schäffler vom Büro Schäffler Sinnogy, der die Machbarkeitsstudie erstellt hatte, betonte: „Die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Hier kann man mit relativ wenigen Erdwärmesonden auskommen, um das gesamte Baugebiet zu beheizen.“ Das Gebiet Kälberwaid umfasst 1,7 Hektar und soll Platz für rund 90 Wohneinheiten in Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäusern mit Mietwohnungen bieten.

Den Gesamtwärmebedarf berechnet die Studie je nach Bedarfszenario zwischen 361 und 474 Megawattstunden, die erforderliche Entzugsleistung zwischen 148 und 200 Kilowatt. Der Strombedarf soll im Gebiet Kälberwaid über Photovoltaikanlagen gedeckt werden. Der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung sieht diese sogar als Pflicht für künftige Bauherren vor. Für Haushalte, Wärmepumpen und E-Fahrzeuge geht der Experte von einem Gesamtstrombedarf von 365 Megawattstunden pro Jahr aus. Der gesamte Energiebedarf kann nach der Berechnung des Experten bei garantiertem Wärmepreis gedeckt werden.
Weiter untersucht wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie, ob eine gemeinschaftliche Lösung für das gesamte Gebiet oder eine individuelle Versorgungsvariante für jedes Gebäude die idealere Lösung darstellt. Im Ergebnis sagt die Studie, das gemeinschaftlich genutzte Erdwärmenetz mit Vernetzung aller Gebäude durch das Kalte Nahwärmenetz bei Verwendung von Sole-Wasser-Wärmepumpen und PV-Anlagen habe mehr Vorteile. So fordere es zwar einen erhöhten Planungsaufwand für den Bauträger und zusätzliche Investitionskosten für das Wärmenetz, es biete aber insbesondere höhere und gesicherte Fördermittel und einen geringen Finanzierungsbedarf für die Bauherren.
Eine einstimmige Entscheidung
Auf Grundlage dieser Machbarkeitsstudie beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Umsetzung der gemeinschaftlichen Versorgungsvariante voranzutreiben. Dazu wird nun eine detaillierte Fachplanung erstellt, ein Geschäftsmodell für die kommunale Betreibergesellschaft erarbeitet und die Gemeinde sichert sich die Fördermittel.
Der Gemeinderat von Mönchweiler folgt damit der Auffassung von Bürgermeister Rudolf Fluck: „Wer vom Klimaschutz spricht, muss etwas dafür tun.“ Gemeinderat Andreas Staiger ist sich sicher: „Ich bin überzeugt davon, dass wir durch dieses Konzept für das Baugebiet mehr Interessenten bekommen als uns durch die Vorgaben abspringen.“