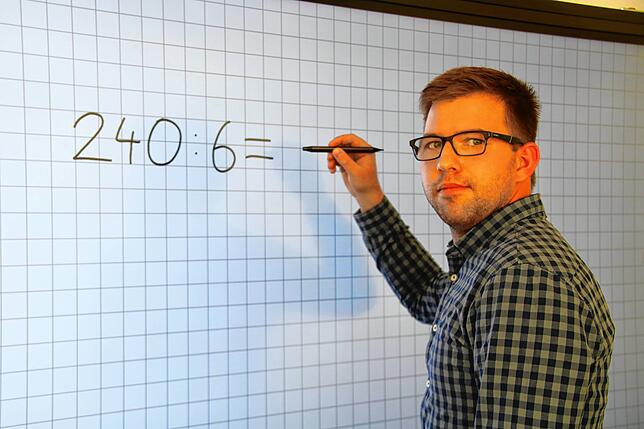Lernen im Ausnahmezustand der Corona-Krise: Könnte die Politik mehr tun oder reicht dies? Eine Allensbach-Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit mit der Schulpolitik des Landes in der Corona-Krise unzufrieden ist. 35 Prozent der Befragten attestieren eine „weniger gute Arbeit“, 22 Prozent „keine gute Arbeit“. Nur ein bisschen mehr als ein Drittel (31 Prozent) sieht keinen Anlass zur Kritik und schätzt die Arbeit als gut ein, drei Prozent loben eine sehr gute Arbeit. Doch wie bewerten Schulleiter, Lehrer und Elternvertreter im Schwarzwald-Baar-Kreis die Situation vor Ort – hier ihre Einschätzungen:
Was die Schulleiter sagen
Jochen von der Hardt vom Villinger Gymnasium am Romäusring: Von der Hardt hat hohen Respekt vor der Politik. Derjenige, der jetzt kritisiere, solle überlegen, ob er derzeit den Job im Kultusministerium gern übernehmen würde. Aus seiner Sicht entscheide vor allem, ob die Regeln in der Praxis schnell umsetzbar seien. Es gebe zwar auch jetzt wieder Eltern, die das Lüften alle 20 Minuten und das Maskengebot für unzumutbar halten. Doch damit stelle sich die Frage, welche Alternative es gebe. Entlüftungsgeräte seien entweder teuer oder müssten erst aufwendig eingebaut werden. Ziel sei es ja nach wie vor, den Präsenzunterricht so gut es geht aufrechtzuerhalten. In der Woche vor den Herbstferien musste wegen der steigenden Infektionszahlen der Nachmittagsunterricht in der Schule zugunsten des „Homeschooling„, also der Schule zuhause, aufgegeben werden – zumindest für die Klassen bis zur Kursstufe. Defizite sieht von der Hardt eher bei der Digitalisierung, vor allem bei der Ausstattung mit Geräten. Lehrer zum Beispiel würden derzeit ihre privaten Computer nutzen.

Martin Zwosta von den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen (KHS) am Standort Donaueschingen: Er sieht sein Haus gut gerüstet. „Wir haben die Möglichkeit, unsere Schüler per Video aus der Ferne zu unterrichten. Dabei helfen uns vorhandene Leihgeräte genauso wie eine Online-Lernplattform mit Chat-Funktion zum gegenseitigen Austausch.“
Was der Lehrer sagt
Mark Lopes Videira von der Eichendorffschule in Donaueschingen: Hier schreitet die Digitalisierung Schritt für Schritt voran. Tageslichtprojektoren gebe es dort seit ein paar Jahren nicht mehr, dafür aber moderne Dokumentenkameras, digitale Tafeln und Tablets. Seit Corona wurden laut des Lehrers Mark Lopes Videira einmal mehr die Defizite aufgezeigt, die es mindestens im Land Baden-Württemberg an den Schulen gebe. Dem 31-Jährigen liegt nach eigener Aussage vor allem das Thema Bildungsgerechtigkeit am Herzen. Nicht erst seit den Pisa-Studien wisse man, dass in Deutschland die Herkunft einen starken Einfluss darauf habe, ob ein Schüler Bildungserfolg hat oder nicht. „Es wurden bislang zu wenige Maßnahmen getroffen, um dem gegenzusteuern. Die Digitalisierung ist in den Schulen über Jahre und Jahrzehnte verschlafen worden“, sagt Lopes Videira deutlich. Er hätte sich gewünscht, dass direkt zu Beginn der Pandemie Lehramtsstudenten in den Schulen eingesetzt worden wären: „Damit hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil einerseits Praxiserfahrung gesammelt und andererseits die Schulen entlastet worden wären. Den Studenten sind außerdem Corona-bedingt viele Nebenjobs weggefallen, auf die sie finanziell angewiesen sind.“
Was die Elternvertreter sagen

Tino Berthold, Vorsitzender Gesamtelternbeirat der Schulen in Villingen-Schwenningen: Manche Vorgaben des Kultusministeriums seien nicht praktikabel, moniert er. Als Beispiel nennt er die Regelung, dass nach den Sommerferien die Kinder schon am ersten Schultag einen von den Eltern unterschriebenen Zettel hätten mitbringen sollten, dass sie nicht in einem Risikogebiet urlaubten. Das sei unrealistisch gewesen und wenig später sei die Kultusbehörde auch zurückgerudert und habe die Frist verlängert. Aus Sicht von Berthold sollten die Eltern besser in die Kommunikation eingebunden werden. Derzeit würden sie oft außen vor gelassen. Dass die Politik die Digitalisierung verschlafen habe, hält er für einen zu harten Vorwurf. Das sei „ein zu böses Wort“, Versäumnisse habe es gegeben. Wenn jetzt Schüler und Lehrer mit Endgeräten ausgestattet werden, hält er es für wichtig, auch alle Schüler, vor allem die schwächeren an den Computern so einzulernen, dass sie die Geräte für das Fortkommen in der Schule nutzen können.

Boris Florijanovic, Elternbeiratsvorsitzender am Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen: Worüber er sich zur Zeit Gedanken mache, sei das ständige Lüften der Klassenzimmer. „Ich weiß nicht, wie die Kinder das durchhalten sollen“, sagt er mit Blick auf die anstehenden Wintermonate. Sein Sohn, der die 9. Klasse besucht, sei schon krank zuhause gewesen mit einer Erkältung. Auch das liege am Lüften, glaubt Florijanovic. „Die Verantwortlichen im Kultusministerium sind sich ihrer Forderung nicht bewusst“, findet er. Und fügt an: „Gerne dürfen sie es im Ministerium ausprobieren, bei kalten Temperaturen und bei offenen Fenstern ohne Heizung stundenlang zu arbeiten.“ Jeder Pädagoge handhabe das Lüften anders: Manche öffnen alle 20 Minuten die Fenster, andere wiederum lassen die Fenster die gesamte Schulstunde über offen. Ob er die Vorgaben des Landes ansonsten für sinnvoll hält? „Ja, grundsätzlich machen die Vorgaben Sinn“, sagt Florijanovic. Es gebe einen „ordentlichen Präsenzunterricht“, Klausuren würden geschrieben, Noten vergeben und der soziale Kontakt zu Mitschülern und Lehrern sei da – ganz im Gegensatz zu der Zeit vor den Sommerferien. Die Anzahl der Eltern, die sich beschweren würden, halte sich „sehr in Grenzen“. Vielmehr kämen vonseiten der Eltern Anregungen, um den Schulalltag zu optimieren. Beispielsweise Luftfilter einzubauen anstelle der Lüfterei. Ansonsten würde sich „die breite Masse anpassen“, beobachtet er – sowohl die Eltern als auch die Schüler. Was die Digitalisierung betrifft, habe die Schule „einen guten Schritt vorangemacht“. Aber: „Es können nicht innerhalb von wenigen Monaten die verpassten vergangenen 15 Jahre aufgeholt werden.“ Rund 40 Laptops seien mittlerweile angeschafft worden. Gedacht seien diese vor allem für diejenigen Schüler, „die zuhause nicht über moderne Technik verfügen“. Von der Schulleitung und den Lehrkräften fühlt sich Florijanovic gut unterstützt. Dabei lobt er vor allem die Homepage der Schule, auf der „alles Wichtige abrufbar“ sei und Schüler und Eltern stets zeitnah über Neuerungen informiert würden.

Die Umfrage der Tageszeitungen
Wie zufrieden sind die Menschen in Baden-Württemberg mit der Arbeit der Landesregierung? Werden die richtigen Schwerpunkte gesetzt, wo wird nur geredet, wo wird gehandelt? Das wollen die Tageszeitungen in Baden-Württemberg in ihrer gemeinsamen Umfrage, dem BaWü-Check, genauer wissen und arbeiten dafür mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) zusammen. Das IfD befragt einmal im Monat im Auftrag der Tageszeitungen mehr als 1000 Menschen im Land, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Das IfD gehört zu den namhaftesten Umfrage-Instituten Deutschlands, auf den Rat der IfD-Chefin Renate Köcher greifen Vorstandsvorsitzende, Regierungschefs und Verbände zurück. Die gedruckten Tageszeitungen in Baden-Württemberg erreichen jeden Tag mehr als fünf Millionen Menschen, hinzu kommen die Leserinnen und Leser auf den reichweitenstarken Online-Portalen der Tageszeitungen.
Die erste Umfrage widmete sich dem Thema Corona und die Schulen: Wie gut hat die Landesregierung das Thema im Griff? Wie läuft es in den Schulen?
Der Check im Online-Dossier:
http://www.suedkurier.de/check