„Ich habe mindestens 1100 Menschen begleitet“, sagt Mechthild Wohnhaas-Ziegler. Sie spricht sachlich, unaufgeregt. Dabei meint sie nichts anderes als: Ich habe mindestens 1100 Menschen kurz vor dem Tod, viele auch in den Tod begleitet. Das sind im Schnitt 80 bis 120 Menschen pro Jahr.
Mechthild Wohnhaas-Ziegler ist Pflegedienstleitung im Hospiz Via Luce, am Stadtrand von Schwenningen. Seit 13 Jahren gibt es das Hospiz und seitdem ist sie hier. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Gerlinde Faller sitzt sie im modern eingerichteten Aufenthaltsraum. Bücherregale an der Wand, Pflanzen vor den großen Fenstern, in der Ecke eine Gitarre. Von draußen ist das leise Rascheln der Blätter zu hören, vereinzelt kämpfen sich Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke. Irgendwie fühlt es sich hier gar nicht nach Sterben an.

„Es geht uns um das Leben, nicht um das Sterben.“Mechthild Wohnhaas-Ziegler
Wohnhaas-Ziegler bestätigt den Eindruck: „Viele denken, ein Hospiz ist nur schwer und anstrengend, doch es wird hier viel gelacht.“ Viel gelacht? In einem Hospiz? „Es geht uns um das Leben, nicht um das Sterben“, erklärt sie. Es gehe darum, „Freude zu schenken, Sinn zu geben“. Oftmals hätten die Erkrankten während unzähliger Therapien und endlosen Krankenhausaufenthalten „das Leben vergessen“. Das soll sich im Hospiz ändern.

Ein Beispiel: Heute, erzählt Wohnhaas-Ziegler, stehe für einen Mann eine ganz besondere Begegnung an. Seit vier Wochen habe er seinen Hund nicht mehr gesehen, einen Husky, sein ein und alles. Heute werde das Tier zu ihm ins Hospiz gebracht. „Das ist Lebensqualität“, findet Gerlinde Faller: Ein vermeintlich kleiner Wunsch, der dem Patienten jedoch alles bedeutet.
Selbstbestimmt bis zuletzt
Dem Patienten? Nein – Mechthild Wohnhaas-Ziegler korrigiert: „Wir sprechen von Gästen.“ Und erklärt auch, warum: Das lateinische Wort hospitare bedeutet so viel wie beherbergen. Und genau das möchte das Pflegeteam. Den 16 Pflegekräften – 15 davon weiblich, eine männlich – ist es wichtig, dass der Gast selbstbestimmt im Hospiz leben kann und zwar „bis zuletzt“, betont Wohnhaas-Ziegler. Heißt: „Er gibt den Takt an.“

Der kürzeste Aufenthalt: fünf Minuten
Das Hospiz hat Platz für acht Personen. Was ihnen gemeinsam ist: Alle leiden an einer fortgeschrittenen Erkrankung, allen bleibt nicht mehr viel Zeit. Alle sind unheilbar krank. „Etwa 90 Prozent aller Erkrankten sind Krebspatienten, ungefähr zehn Prozent leiden an einer chronischen Erkrankung“, berichtet Wohnhaas-Ziegler. Sie selbst hat das Hospiz mit aufgebaut, hat hunderte Schicksale kommen und gehen sehen. Die kürzeste Aufenthaltsdauer: fünf Minuten. Die längste: neun Monate. Im Schnitt, schätzt sie, sind die Betroffenen vier bis sechs Wochen hier. Der jüngste „Gast“ war 20, der älteste 96.

Sowohl Mechthild Wohnhaas-Ziegler als auch Gerlinde Faller haben zuvor als Krankenschwestern gearbeitet – auf Intensiv und in der Anästhesie. Beide merkten irgendwann: „Ich bin müde, das zu tun“, wie es Wohnhaas-Ziegler ausdrückt. Müde von der Hektik, dem Stress. Der Wunsch reifte, mehr Zeit zu haben, zuhören zu können. Denn zu einer „Rundumbetreuung“, wie es die beiden nennen, gehöre nun einmal nicht nur die Körperpflege und Versorgung mit Medikamenten, sondern eben auch die psychische Betreuung. Und die brauche Zeit und Ruhe.

„Nicht jeder akzeptiert den Tod“Mechthild Wohnhaas-Ziegler
Und dann ist da noch die die Begleitung der Angehörigen. Ein großer Teil ihrer Arbeit. „Nicht jeder“, weiß Wohnhaas-Ziegler, „akzeptiert den Tod eines geliebten Menschen. Da braucht es viel Zeit und Raum für Gespräche.“ Das könne durchaus anstrengend sein. Beispielsweise dann, wenn es um das Thema Essen und Trinken geht. Wenn ein Patient die Nahrung verweigert und die Angehörigen das nicht hinnehmen wollen. Was dann? „Wir positionieren uns zu dem Gast“, so Faller. Der Wunsch des Gastes, auch wenn dieser bedeutet, nicht mehr essen und trinken zu wollen, wird von dem Pflegepersonal respektiert. Denn: „Das gehört zum Sterbeprozess dazu“, weiß Wohnhaas-Ziegler aus Erfahrung.
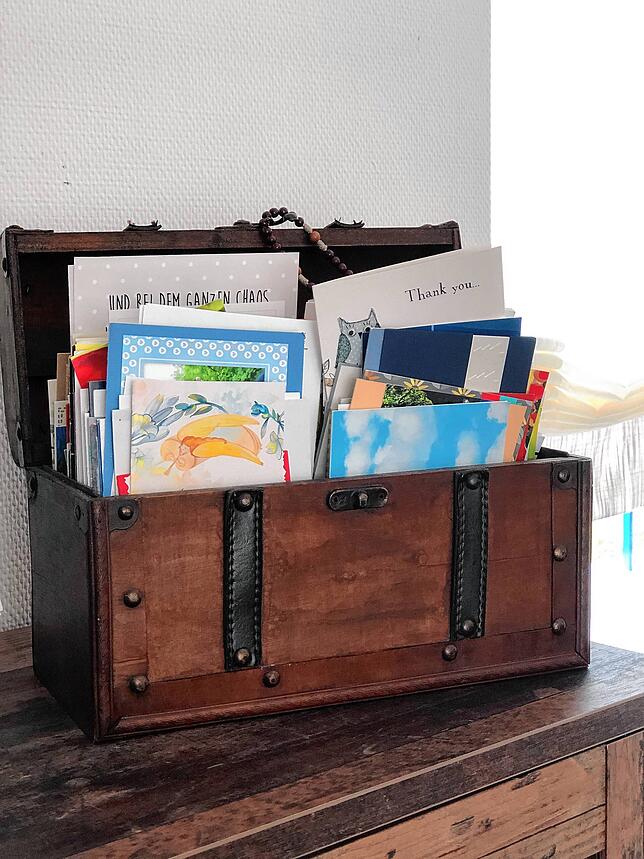
Haben Mechthild Wohnhaas-Ziegler und Gerlinde Faller eigentlich selbst Angst vor dem Tod? „Nein“, sagen beide. Wohnhaas-Ziegler zögert kurz und fügt hinzu: „Ich kann nicht ausschließen, dass ich es vielleicht kurz vorher haben werde.“ Zu sterben habe schließlich viel mit Loslassen zu tun – loslassen von Gewohntem, von Angehörigen, vom Leben. „Das kann beängstigend sein.“
Sie stellt sich das Sterben wie Bergsteigen vor. Es sei anstrengend, den Berg zu erklimmen, es könne mühsam sein und eine ganze Weile dauern. Sei man schließlich auf dem Gipfel angekommen, sei die Anstrengung verschwunden, man lasse sich fallen. „Und dann fliegt man in eine andere Welt, wo auch immer diese sein mag. Man wird getragen. Das Leid ist weg und das Kapitel Leben abgeschlossen.“
Beide Frauen glauben nicht, dass es mit dem Tod vorbei ist. Auch wenn die Pflegerinnen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was danach kommt, gibt es eine Sache, die allen Pflegern im Team gemeinsam ist: „Nicht glauben tut hier keiner. Jeder glaubt an etwas“, sagt Wohnhaas-Ziegler.

Die beiden Frauen schaffen es, ihre Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Trotz, dass manche Gäste und Lebensgeschichten sie berühren. „Der Tod ist eher ein Segen für die Menschen“, findet Wohnhaas-Ziegler. Etwas anderes nimmt sie für sich persönlich mit: nämlich Dinge nicht auf die lange Bank zu schieben. Für sie gibt es kein „das mache ich irgendwann einmal“. Zu kurz sei das Leben, zu ungewiss der Tod. Außerdem, erzählt die Pflegedienstleitung, sei sie demütiger geworden. „Bei dem letzten Atemzug eines Menschen dabei sein zu dürfen, ist einzigartig und berührend.“

Am Ende, sagt Gerlinde Faller, reduziere sich alles auf das Wichtige im Leben. Und das sei nicht der Wunsch nach einer Heißluftballonfahrt oder einem dicken Auto, sagt sie und lacht. Das sind Dinge wie: Das letzte Mal den Hochzeitstag zu feiern. Für sich und die Freunde chinesischen Essen zu bestellen. Noch einmal Eishockey zu spielen. Einfach nur Zeit zu haben – mit den Angehörigen, mit Freunden. Das sei das einzige, was am Ende wirklich zählt.
Wussten Sie, dass...?
... gerade einmal vor 36 Jahren, nämlich 1986, das erste stationäre Hospiz in Deutschland eröffnet wurde? Und zwar im nordrhein-westfälischen Aachen.
... für die Betroffenen ein Platz im Hospiz kostenlos ist? Das ist allerdings erst seit 13 Jahren der Fall. Seit 2009 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen 95 Prozent der Kosten, das Hospiz übernimmt die restlichen fünf Prozent.
... es in Baden-Württemberg 38 stationäre Hospize gibt?






