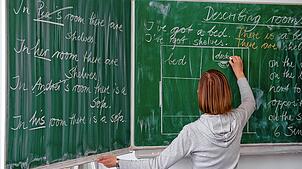Zum Abschluss der Nachhaltigkeitswoche in St. Georgen lud die Stadtverwaltung St. Georgen zu einem Vortrag über umweltschädliches Modeverhalten ein. Als Referentin war mit Carmen Maiwald eine Investigativ-Journalistin in Sachen Mode eingeladen.
Jede Woche neue Kollektionen
Die Zeiten, in denen Modelabels jeweils eine neue Kollektion im Frühjahr und im Herbst auf den Markt brachten, sind lange vorbei. Anbieter wie Temu, Shein, Cider und Zara überschwemmen den Modemarkt und damit verbunden die Kleiderschränke gefühlt jede Woche mit einer neuen und preisgünstigen Kollektion.
Fast Fashion nennt sich das – schnelle Mode. Unter welchen Bedingungen die Billig- und Billigstklamotten produziert werden, deckte Carmen Maiwald auf.
Menschenunwürdige Zustände
Ein Top für drei Euro, T-Shirts im Dreierpack für einen schlanken Zehner. Wer da nicht zugreift, ist selber schuld. Oder? Was aber vermeintlich den Geldbeutel schont, muss an anderer Stelle teuer bezahlt werden.
Carmen Maiwald recherchiert intensiv zum Thema Fast Fashion. Was sie dabei an menschenunwürdigen Zuständen zutage fördert, sorgte bei den Zuhörern für fassungsloses Kopfschütteln.
Verlockend billig
Dabei outete sich Carmen Maiwald zu Beginn direkt selbst als ehemalige Konsumentin solcher Billigware. „Es war schon ein tolles Gefühl, für wenig Geld eine volle Tasche mit Klamotten zu bekommen“, beschrieb sie das Glücksgefühl ihrer Beutezüge für Billigklamotten.
Heute will sie umso eindringlicher darüber aufklären, welche Auswirkungen dieses Verhalten hat. „Im Schnitt hängen in jedem Kleiderschrank pro Person 87 Kleidungsstücke. Jedes fünfte Kleidungsstück wird nur zwei Mal im Jahr getragen“, untermauerte Maiwald ihren Vortrag mit Zahlen.
Stundenlohn zwei Dollar
Den Ausschlag für ihre ganz persönliche Abkehr vom Billigkonsum gab die Besichtigung einer Näherinnenwerkstatt in den USA noch zu Studentenzeiten. Sie kam ins Gespräch mit einer Frau, die für zwei US-Dollar Stundenlohn an sechs Tagen die Woche jeweils zwölf Stunden in einem fensterlosen Raum Pullover näht, die später für 25 Dollar verkauft werden.
Auch die Umwelt leidet massiv
Nicht nur die Menschen, auch die Umwelt leidet unter dem Modewahn. Nicht nur, weil für die Herstellung von Textilien Unmengen von Wasser benötigt werden und die Klimabilanz katastrophal ist. „Eine Fast-Fashion-Fabrik produziert so viele Emissionen wie das Land Slowenien in einem Jahr“, verdeutlichte die Journalistin. Auch seien Umweltstandards im Ausland oft verheerend.
Textilfabriken in der Türkei beispielsweise leiteten ihre Abwässer einfach in Flüsse, die dadurch stark verunreinigt würden: „Wir haben Wasserproben untersuchen lassen und herausgefunden, dass bis zu 6500 Chemikalien im Wasser enthalten sind.“ Über den Import kommen diese Textilien nach Deutschland. Und über das Waschen gelangten diese teils giftigen Chemikalien auch in unseren Wasserkreislauf, gab Maiwald zu bedenken.
Brauche ich das wirklich?
Was also können die Konsumenten tun, um sich nicht an diesem Umwelt- und menschenverachtenden Modesystem zu beteiligen? „Kein Onlineshopping bei Billiganbietern. Sondern in den Geschäften vor Ort einkaufen.“ Dort könne die Ware zudem auch angefasst und gefühlt werden.
Auch den Konsum einzuschränken sei eine Möglichkeit: „Vielleicht nicht gleich beim ersten Impuls zugreifen, sondern überlegen, brauche ich dieses Kleidungsstück jetzt wirklich?“
Ein sicheres Gefühl sei auch, beim Kauf von Kleidung auf Umweltlabels zu achten. Hier sei jedoch wiederum Vorsicht geboten. „Manche Unternehmen entwickeln einfach eigene Labels, um so Umweltverträglichkeit vorzutäuschen. Das nennt man Greenwashing“, so Maiwald.
In einer kurzen Diskussionsrunde gaben die Zuhörer der Referentin vollumfänglich recht. „Aber das Problem ist, dass die Kunden heute eben Vier-Euro-Stücke haben wollen“, berichtete die Betreiberin eines Modegeschäfts aus eigener Erfahrung.