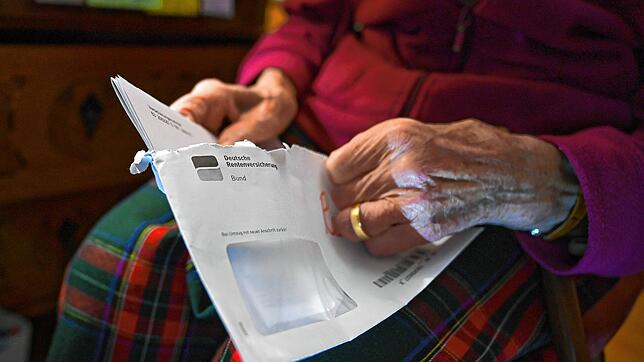Die Schweiz hat ein Problem. Das Rentensystem leidet trotz Zuwanderung von jungen Arbeitnehmern aus dem Ausland zunehmend an der Demografie. Geht die Entwicklung so weiter, gerät die Grundrente in der Schweiz, die sogenannte Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) in Schieflage. Mehrere Reformversuche scheiterten in der Vergangenheit, zuletzt 2017. Nun steht ein überarbeiteter Entwurf zur Abstimmung.
Der Kern: Das Renteneintrittsalter von Frauen von 64 auf das der Männer mit 65 Jahren anzugleichen. Die Debatte darum ist in der Schweiz vollkommen „politisiert“, sagt Thomas Gächter von der Universität Zürich, wo er den Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und Sozialversicherungsrecht innehat. Eine sachliche Debatte sei kaum möglich, so der Rentenexperte.

Kein einziger Schweizer Journalist habe sich bislang mit Blick auf das bevorstehende Referendum an ihn gewandt. In Schweizer Medien werden stattdessen hitzige Genderdebatten geführt. Wie die Volksabstimmung am 25. September ausgeht, ist ungewiss. Warum das System eine Reform braucht und wo die Probleme liegen, haben wir hier zusammengestellt.
Wie funktioniert das Schweizer Rentensystem eigentlich?
Das Schweizer System ist auf drei Säulen gebaut. Die AHV ist so etwas wie eine Basisrentenversicherung. Anders als in Deutschland zahlen alle Berufstätigen ein, also auch Staatsbedienstete aller Art und Selbstständige. Einen Minimalbeitrag von 413 Franken im Jahr müssen sogar Arbeitslose und Studenten einzahlen.
Die Mindestaltersrente beläuft sich auf monatlich 1195 Franken, die Maximalrente ist gedeckelt: Demnach können Rentner höchstens 2390 Franken aus der AHV beziehen (bei einem früheren Jahreseinkommen von mindestens etwa 85.000 Franken). Wie hoch die Rente ausfällt, hängt davon ab, wie lange Beiträge eingezahlt wurden.
An die Schweizer AHV gehen bei Angestellten 8,7 Prozent des Lohns – die Hälfte zahlt der Arbeitgeber. Selbstständige müssen 8,1 Prozent des Lohns abführen. Eine Beitrags-Obergrenze besteht nicht, wer sehr viel verdient, muss auch sehr viel bezahlen – obwohl seine Maximalrente dadurch nicht mehr steigt. „Die AHV ist deshalb eine große Umverteilung von Reich nach Arm“, erklärt Gächter.
In Deutschland ist es anders, es gibt die Beitragsbemessungsgrenze: Wer in den alten Bundesländern mehr als 7050 Euro im Monat verdient (neue Bundesländer 6750 Euro), muss auf den Zusatzverdienst keine Rentenabgaben mehr leisten.
Die zweite Säule der Schweizer Rente ist die sogenannte BVG, die betriebliche Rentenversicherung. Sie ist anders als die erste Säule kapitalgebunden und ab Jahreseinkommen von derzeit 21.510 Franken verpflichtend, allerdings nicht für Selbstständige.
Der BVG-Beitrag erhöht sich mit dem Lebensalter und liegt zwischen sieben und 18 Prozent des Lohns, auch hier zahlt der Arbeitgeber die Hälfte. 6,8 Prozent des angesparten und verzinsten Geldes bekommen die Schweizer Rentner dann Jahr für Jahr ausgezahlt.
Anders als in Deutschland gibt es in der Schweiz also für viele Arbeitnehmer zwei verpflichtende Rentenkassen, in die sie einzahlen. In Deutschland beträgt der Rentenbeitrag 18,6 Prozent, ebenfalls hälftig getragen vom Arbeitgeber.
Die dritte Schweizer Säule ist vergleichbar mit der deutschen Riester- oder Rürup-Rente. Hier können Arbeitnehmer zusätzlich privat investieren, um ihre Altersvorsorge aufzubessern. Sie wird einmalig ausbezahlt bis zu fünf Jahren nach Renteneintritt.

Wie viel Rente braucht man zum Leben in der Schweiz?
Das hängt sehr davon ab, wo man lebt. In ländlichen Räumen brauche man 3000 bis 3500 Franken pro Monat, in städtischen Gebieten mindestens 3500 bis 4000 Franken. „Gut leben werden Sie damit aber nicht“, stellt Gächter klar.
In Zürich müssten Rentner schon mit etwa 2400 Franken allein für die Miete rechnen, hinzu kommen privat zu leistende Krankenkassenbeiträge von 300 bis 400 Franken, rechnet Gächter vor.
Was sieht die Reform eigentlich vor?
Sie sieht vor, das Renteneintrittsalter der Frauen von 64 Jahren auf 65 Jahren anzuheben, um die AHV weniger zu belasten. Dadurch könnten 1,5 Milliarden Franken an Rentenbezügen gespart werden, so Gächter.
Die Reform ist gekoppelt mit einer leichten Anhebung der Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1 Prozent. Damit soll zusätzlich Geld in die Rentenkasse kommen: 12,4 Milliarden will der Staat so generieren, erklärt Gächter, um die AHV zumindest bis 2030 finanzierbar zu halten.
Warum ist dieses Referendum besonders kompliziert?
Beide Reformen sind miteinander gekoppelt. Scheitert eine von beiden, wird auch die andere nicht umgesetzt.
Hinzu kommt, dass es für Verfassungsänderungen nicht nur eine Mehrheit der Bevölkerung braucht. Auch die einzelnen Kantonsresultate müssen in der Mehrheit zustimmend ausfallen, das sogenannte Ständemehr. Die Prognosen deuten derzeit darauf hin, dass die Reform knapp durchkommen könnte. „Ich bin verhalten optimistisch, dass das gelingt“, so Gächter.
Warum braucht es eine Reform?
Die Schweiz leidet trotz massiver Zuwanderung junger, qualifizierter Arbeitnehmer aus dem Ausland unterm Strich an der eigenen Demografie: Immer weniger Menschen zahlen für immer mehr Rentner ein. „Bis 2050 zahlen nur noch 2,2 Arbeitnehmer für einen Rentner ein“, so Gächter. Zu Beginn der Rente 1948 kamen auf einen Rentner dagegen 6,5 aktiv Versicherte.
Hinzu kommt, dass jetzt hinzukommende ausländische Arbeitnehmer später ebenfalls Ansprüche auf die Schweizer Rente haben. „Das Problem verlagert sich also nur“, erläutert Gächter.
Weshalb haben Frauen bislang überhaupt ein niedrigeres Renteneintrittsalter?
Das ist historisch bedingt. Tatsächlich lag das Renteneintrittsalter in der Schweiz schon einmal bei 65 Jahren für alle. Durch den Boom der Nachkriegsjahre wurde das Rentenalter zwischenzeitlich auf 62 Jahre abgesenkt.
Weil bis 1971 nur Männer stimmberechtigt waren, entschieden sie, dass Frauen ob der häufigen Doppelbelastung von Familie und Beruf die frühere Rente erhalten.
Ende der 90er Jahre (als Frauen das Stimmrecht längst hatten) wurde das Rentenalter für sie auf 64 Jahre angehoben. „Vorgesehen war aber immer, das Renteneintrittsalter ganz an die Männer anzupassen“, so Gächter. Doch mehrmals scheiterten Reformen an den fehlenden Mehrheiten, zuletzt 2017.
Haben es Rentner in der Schweiz derzeit besser als in Deutschland?
Grundsätzlich ja. Das Renteneintrittsalter ist selbst bei einem erfolgreichen Referendum für beide Geschlechter noch niedriger als in Deutschland, wo es für alle Jahrgänge ab 1964 bei 67 Jahren liegt.
Bei der Schweizer Rentenzahlung hängt es sehr davon ab, wie viel man verdient. Geringe und mittlere Einkommen sind durch die ersten beiden Säulen des Rentensystems sehr gut abgesichert, so Gächter. Sie kommen im Alter auf etwa 60 Prozent ihrer ursprünglichen Einkünfte.
Bei höheren Einkommen sinkt der Satz aber durch die Deckelung der Beiträge auf 40 bis 45 Prozent. „Davon kann man aber immer noch sehr gut leben“, so Gächter.
In Deutschland ist das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent festgeschrieben – auch hier ist die gesetzliche Rente für Gutverdiener aber gedeckelt.

Was passiert, wenn die Reform scheitert?
„Dann laufen wir in ein Defizit“, erläutert Gächter. In sechs bis sieben Jahren schon dürfte seinen Schätzungen zufolge der AHV-Fonds aufgebraucht sein, in dem eigentlich immer eine Jahresreserve an Rentenbezügen zurückbleiben sollte.
Um das Defizit auszugleichen, wären Steuererhöhungen oder zusätzliche Lohnabzüge nötig, die im Hochpreisland Schweiz aber politisch kaum umsetzbar wären, fürchtet Gächter. Andernfalls müssten die Rentenbezüge gesenkt werden – was ob der hohen Lebenshaltungskosten mindestens ebenso problematisch wäre.
Warum wird das Rentenalter nicht generell für alle angehoben?
Das wäre der nächste Schritt, so Gächter. Politisch ist dieser Schritt aber nur schwer durchsetzbar. „Da ist uns Deutschland um einiges voraus“, betont er. Die Anpassung des Rentenalters der Frauen aber wäre ein erster Schritt, um sich zeitlichen Spielraum zu verschaffen, um dann grundsätzlichere Reformen anzugehen.
Gächter verweist auf das skandinavische Modell. In Dänemark etwa wird das Renteneintrittsalter proportional an die steigende Lebenserwartung angepasst. Der Vorteil: „Das ist ein Mechanismus, der sich selbst anpasst, ohne dass es immer wieder Abstimmungen bedarf.“