Der Einkaufstourismus lief 1938 noch in die andere Richtung. Aus Säckingen kamen Hunderte Personen über die Holzbrücke, um sich in Stein mit Schokolade, Zucker oder Kaffee einzudecken. Die Lebensmittel waren dort preis- und hochwertiger.
Der Kurs war günstig. Für eine Reichsmark gab es 1,20 bis 1,30 Schweizer Franken. Die engen sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Grenzregionen waren von gegenseitiger Hilfe und Austausch geprägt. Doch die Nazis beäugten diesen Grenzverkehr kritisch, kamen die Säckinger doch in Stein in den Genuss demokratischer Zeitungen.
Der Grenzverkehr bricht 1939 ein
Als sich die politische Lage zuspitzte und der Silbermarkkurs inflationierte, brach der Grenzverkehr bis 1939 ein. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs war es nur noch wenigen erlaubt, die Grenze zu passieren. Etwa Personen, die in der Rüstungsindustrie beschäftigt waren.
Schweizer, die in Säckingen arbeiteten, wurden beim Grenzübertritt streng kontrolliert. Etwa durften diese ihr Pausenbrot nicht in Schweizer Zeitungspapier wickeln. Die Nazis sanktionierten Widerhandlungen mit Arrest.
Schwere Geschütze an der Holzbrücke
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs – am 1. September 1939 – fuhren die Schweizer an der Holzbrücke schwere Geschütze auf. Nachts versperrte eine Tankbarriere den Übergang über die Brücke in die Schweiz, der Brückenbereich war mit Stacheldraht umgeben.
Zudem wurde eine betonierte Maschinengewehrstellung hinter dem Zollhaus errichtet, die sich in gerader Linie zur Brücke befand. Gegen die Ausspähung errichtete die Aargauer Radfahrkompanie einen vier Meter hohen Kugelfang aus Holzbrettern um das Zollhaus.
Sprengstoff an den Brückenköpfen
Neben der Sicherung durch Grenzwache und Militär wurde der Brückenkopf mit zwei Minenkammern versehen. Vom Keller des Zollhauses war es Mineuren möglich, über einen unterirdischen Korridor zu den Kammern zu gelangen, um von dort aus bei einer Nazi-Invasion die Brücke in die Luft zu jagen. Doch dazu kam es nie.

Am 25. April 1945 befreiten französische Streitkräfte die Rheinschiene von Wallbach bis Waldshut vom NS-Regime. Wie es der Laufenburger Stadtarchivar Martin Blümcke in einem Beitrag festhält, näherte sich gegen 9.15 Uhr die Vorhut von fünf Panzern amerikanischer Herkunft und einem Jeep Säckingen, das sich kampflos ergab. Ebenso Murg. Um 9.40 Uhr fuhr der Tross die Laufenburger Stadtgrenze an.
Von den Militärs war Laufenburg als Hauptstützpunkt vorgesehen, der auch gegen eine Übermacht zu verteidigen ist. Dort war Hauptmann Robert Voegele der Kommandant von rund 250 Männern. Bereits um 7 Uhr erklärte Hauptmann Robert Voegele seinen Männern, dass Laufenburg unter keinen Umständen verteidigt werde. Die weiße Fahne wurde entrollt, die Waffen im Rhein versenkt.
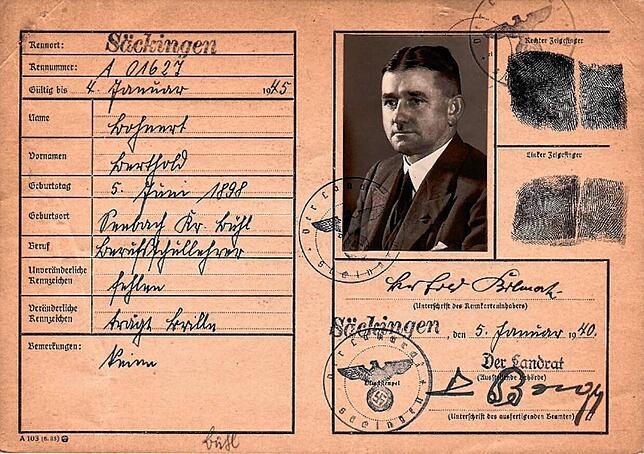
Karl Booz und Josef Matt, die unter anderem die Stadt zur Aufgabe gedrängt hatten, machten sich mit Bürgermeister Bohnert zu den französischen Truppen auf den Weg, um die Kapitulation zu erklären. Doch der enttäuschte Bürgermeister blieb zurück, um in einer Wirtschaft noch ein „Viertele“ zu trinken.
Einmarsch der Franzosen
Als Booz auf einen französischen Offizier traf, fragte dieser ihn, warum er und nicht der Bürgermeister zur Übergabe erschienen sei. Denn so habe die Übergabe der Stadt durch den Bürgermeister zu erfolgen. Die französischen Truppen setzten sich in Bewegung und 700 Meter weiter stießen sie auf den Bürgermeister, der die Stadt dem französischen Befehlshaber übergab.
Der Einmarsch der Franzosen ging ohne Tote, Verletzte oder materielle Schäden einher. Auch die Sprengung des Laufenburger Kraftwerks, die Adolf Hitler mit dem Nero-Befehl erlassen hatte, wurde verhindert. Daran hatte Louis Lang, Postenchef des Schweizer Militärs, Anteil. Er nahm Kontakt zur deutschen Seite auf, bat dort einen Mann, der Zelewski hieß, um Informationen und bot ihm dafür die Ausreise in die Schweiz an.

In der Nacht auf den 25. April übergab Zelewski dem Schweizer Leutnant den Schlüssel zu den Sprengkammern. Kraftwerksmitarbeiter und Schweizer Grenzsoldaten bauten die Nacht durch rund 2000 Kilogramm Sprengstoff aus. Als der deutsche Sprengtrupp am Morgen eintraf, war der Sprengstoff entfernt.
Ebenso nahmen die französischen Truppen am 25. April 1945 die Stadt Rheinfelden kampflos ein. Zwischen dem 21. und 25. April kam es dort über die Grenze in die Schweiz zu einem Übertritt von mehr als 3000 Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen sowie 61 Deserteuren. Das Rote Kreuz nahm sie auf und leitete sie in ihre Heimatländer weiter.
Im Zweiten Weltkrieg mussten im heutigen Gebiet der Landkreise Lörrach und Waldshut mehrere Tausend ausländische Zwangsarbeiter in Industrie und Landwirtschaft arbeiten, um die Deutschen zu ersetzen, die für den Kampf eingezogen waren. Unter ihnen gab es sogenannte „freiwillig“ angeworbene Fremdarbeiter – jene, die einen Arbeitsvertrag hatten. Sowie Zwangsverschleppte oder Kriegsgefangenen, die ohne Vertrag zur Arbeit für den Feind gezwungen wurden.

Damals berichtete die „Schweizer Volksstimme“ über die Geschehnisse. In einem hieß es: „Am 21. und 22. April wälzte sich über die Rheinbrücke Rheinfelden ein großer Flüchtlingsstrom, hauptsächlich Fremdarbeiter in Zivil. Dem hiesigen Auffanglager wurden 1056 Männer und 342 Frauen und Kinder überwiesen, alles Angehörige aus 17 verschiedenen Nationen. Die im Laufe des Sonntags ebenfalls übergetretenen Sowjetrussen, über 600 – zum größten Teil uniformierte Soldaten – bekamen durch die Stadt Rheinfelden spendierte Stärkung und reisten sodann in ein Auffanglager nach dem Innern der Schweiz weiter.“
In einem weiteren Artikel berichtet die Zeitung, dass am 23. und in der Nacht zum 24. April eine große Anzahl Flüchtlinge, meistens Zivilpersonen, die hiesige Rheinbrücke überschritten haben. „Es waren Angehörige neun verschiedener Nationen, und zwar 585 Männer, 248 Frauen und 46 Kinder, gleichzeitig kehrten 63 Schweizerbürger in ihr Heimatland zurück.“ Vom 24. bis zum Mittag des 25. Aprils sind noch 107 Zivilisten in die Schweiz eingereist, unter ihnen drei Schweizer Staatsangehörige.
Der Autor ist Redakteur der „Aargauer Zeitung“. Dort ist dieser Beitrag auch zuerst erschienen.





