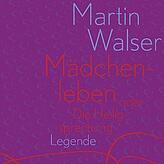„You write damn much“, zitiert Martin Walser in seinem Existenz-Stenogramm „Spätdienst“ (2018) den auf ihn bezogenen Satz eines Amerikaners. Wie wahr. Auch mit 90plus veröffentlicht der Schriftsteller Buch um Buch. Aufhören geht nicht. Nichtstun auch nicht. Er könne nicht einfach zum Fenster hinausschauen und sagen: Toll der See, bekannte er in einem „Welt“-Interview. Und merkte an, dass er keine Romanhandlungen mehr erzählen wolle, sondern nur noch die wesentlichen Momente, die Destillate des Denkens. Das ist die Freiheit, die er sich gibt und er geht damit virtuos um.
In „Spätdienst“ nahm Walser jenen pointierten Aphorismusstil zwischen Lyrik und Essay auf, der dem Leser aus seiner „Meßmer“-Trilogie vertraut ist. Dabei griff er auch auf aufgeschriebene Einfälle und Entwürfe zurück.
Auch sein neues Werk „Mädchenleben oder Die Heiligsprechung. Legende“ hat eine Vorgeschichte. Schon im Tagebuch von 1961 finden sich dazu Skizzen. Und noch einmal wird das auf die lange Bank geschobene Projekt 1979 im Diarium erwähnt. Einige dort ausgeführte Notizen fließen direkt in die Novität ein.
Im Unterschied zum Vorgängerbuch „Spätdienst“ hat „Mädchenleben“ eine Handlung, wenngleich eine magere. Das Buch, von seinem Verlag erst nach der Frankfurter Buchmesse angekündigt, hat 96 luftig gedruckte Seiten. Nicht nur die Sätze sind zuletzt kürzer geworden, die Walser mit seiner abnehmenden altersbedingten Atemkapazität erklärt – er kann nur weiteratmen, wenn ein Punkt da ist –, sondern auch die Bücher dünner. Er bleibt beim Wesentlichen.
Das „Mädchen“ heißt Sirte, eigentlich Gerlinde. Ihre Heiligsprechung betreiben sowohl der seine Frau (Sirtes Mutter) prügelnde und vergewaltigende Vater, der Immobilienhändler Ludwig Zürn (Zürn ist eine guter Bekannter im Werk von Walser), als auch der Lehrer Anton Schweiger, Zimmerherr der Familie und Berichterstatter der „Legende“. Schweiger ist aufgefallen, dass Sirte ein Mädchen wie kein anderes ist und Menschen „entzündet“. Daher hat er damit begonnen, ihre Gesten und Sätze aufzuschreiben, sodass zwischen ihnen bald etwas entstand, „wofür ich keinen Namen habe“.
Heilige oder Verrückte?
Dass Sirte heiliggesprochen werden sollte, wäre ihm nicht eingefallen. Allerdings nahm ihn der Gedanke Zürns nach und nach ein. Dass es dennoch eine verrückte Idee war – das spürte er „durch und durch“. Dem Urteil eines Facharztes, der bei Sirte eine „Anorexia mentalis et nervosa“ diagnostizierte, wollte er nicht folgen.
Sirte benimmt sich in der Tat sehr eigenartig. Wenn es stürmt, rennt sie in den See und will nicht mehr heraus. Verlässt sie das Wasser, redet sie ohne Unterlass, aber keiner versteht sie. Als sie eines Tages wieder einmal verschwindet, gerät der Lehrer („Deutsch und Erdkunde“) unter Verdacht und landet in U-Haft. Er kommt frei, weil das Mädchen wieder auftaucht.
„Ich blühe vor Schmerz“
Sirte isst Ameisen. Und überhaupt: Sie isst nur mit dem Löffel, was die Mutter aufbringt. Dann will sie gar nicht mehr essen. Sie liest Dostojewski und adressiert Briefe an den Lehrer. Bald schreibt sie mehr als sie spricht. Sirte zeigt sich empfindsam, ja lebensängstlich: „Wünsche nicht zu sein./ Ich blühe vor Schmerz. / Gestürzte Bäume sehen aus wie erlöst. / Vom Kinn bis zur Brust bin ich entzündet“. Oder die Malerin Sirte stilisiert sich zur Künstlerin: „Kunst ist dazu da, alles schöner zumachen, als es ist“. Nicht zu vergessen ihr Zerstörungstrieb. Mit Hingebung zerstört sie, bis man ihr die Hände festhält. Dann wird sie ruhig, gelöst, freundlich und atmet wieder.
Lieber mit Gott reden als mit Menschen
Sirte verändert sich, heißt es im Bericht. Sie sucht einen Arzt auf, der ihr eine „seriöse Charakterstörung“ attestiert. Das hält sie nicht auf. Sie nimmt das Neue Testament zur Hand und ist plötzlich der Mund von Nikolaus von Flüe – er gilt als Schweizer Schutzpatron, der 1947 heiliggesprochen wurde. Und „Sirte leuchtet“, schreibt der Lehrer und zitiert seitenweise Sätze aus ihren Tagebüchern und „Lieferungen“. Es sind überwiegend Glaubenssätze: „Gegen Gott ist, wer ohne ihn ist und ihn nicht vermisst“. / „Lieber mit Gott reden als mit Menschen“. „Es gibt kein Leben vor dem Tod“.
„Schreiben, um nicht zu schreien“, heißt es noch weiter. In den Tagebüchern und Lieferungen Sirtes, die als Märtyrerin ein kleines Wunder vollbringt, spricht Walser, das Sterben vor Augen. Dabei erlebt er sich, wie er in dem Interview sagte, als ebenfalls einen anderen, nicht als denjenigen, der klug darüber nachdenkt. Realisten werden das „Mädchenleben“ als Religionskitsch abtun, zumal Walser eine ironische Lesart nicht anbietet – im Gegensatz zu seinem Roman „Muttersohn“ (2011), in dem er mit der Figur Percy einen „Engel ohne Flügel“ schuf. Schon da zeigte er sich fasziniert von der Anziehungskraft des Unerklärlichen, vom Glauben an etwas, „was nicht ist“. Und ja, Legenden werden erst durch Übertreibung schön. Walser weiß das nur zu genau…
Martin Walser: „Mädchenleben oder Die Heiligsprechung. Legende“. Rowohlt, Reinbek. 96 S., 20 Euro. – Ab Dienstag, 19. November, im Buchhandel.