Bei den meisten Obst-Keltereien in Baden-Württemberg hat die Saison begonnen. Seit einigen Tagen können Privatleute und Bauern Äpfel und Birnen zum Pressen bei den Betrieben abgeben. Aber wie viel bekommen sie für ihr Obst? Und lohnt es sich überhaupt, den Buckel krumm zu machen? Ein Überblick über den Streuobst-Markt im Südwesten zu Beginn der Erntesaison:
Wie viel Streuobst gibt es überhaupt in diesem Jahr?
Die Entwicklung über die Jahrzehnte ist klar. In Deutschland wird immer weniger Streuobst vermarktet, auch in Baden-Württemberg, das als Stammland des Streuobst-Anbaus gilt.
Rangierten die jährlichen Erntemengen im Bund nach Daten des Verbands der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) um die Jahrtausendwende noch zwischen 700.000 bis einer Million Tonnen pro Jahr, haben sie sich in den vergangenen Jahren quasi halbiert. Streuobsternten von 450.000 Tonnen, wie sie für das laufende Jahr deutschlandweit erwartet werden, gelten mittlerweile schon als „gut“.

Warum gibt es immer weniger Streuobst?
Streuobstwiesen zu bewirtschaften, ist längst zu einer Liebhaberei geworden. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Obstbau, parallel zur Entwicklung in anderen landwirtschaftlichen Teilgebieten, erheblich professionalisiert.
Im Obstbereich hat intensive Plantagenwirtschaft die klassische Streuobstwiese abgelöst. Obst-Plantagen tragen mittlerweile rund zwei Drittel zur geernteten Apfelmenge bei. Die Streuobstkulturen dagegen sind in die Jahre gekommen und mit einem Durchschnittsalter von bis zu 70 Jahren weit jenseits ihres Ertragszenits.

Ein Geschäftsmodell stellt die Bewirtschaftung der Obstwiesen nicht dar, da sie zu arbeitsintensiv ist und die Abnahmepreise der Keltereien als betriebswirtschaftlich nicht auskömmlich gelten. Staatliche Ansätze, die ökologisch wertvollen Flächen durch Förderung zu erhalten, blieben bislang ohne durchgreifenden Erfolg und können den Verlust von Obstgärten nicht aufhalten.
Besonders durchschlagend ist die Entwicklung in Baden-Württemberg – allein, weil hier noch die größten zusammenhängenden Streuobstgebiete Europas überdauert haben. Am Bodensee, in Oberschwaben oder rund um die Großstädte Stuttgart und Heilbronn prägen sie das Landschaftsbild.
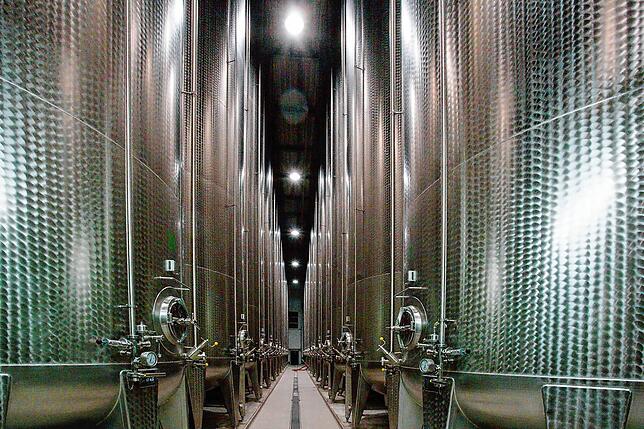
Wie viel bekommen Bauern und Kleinerzeuger für ihr Obst?
Nach Jahren extrem niedriger Apfelpreise von teilweise unter vier Euro je hundert Kilo dreht sich die Lage seit einiger Zeit zugunsten der Kleinerzeuger. 2023 stellte in dieser Beziehung einen Wendepunkt dar. Erstmals seit Jahren kletterten die Erzeugerpreise für Streuobst-Äpfel am Bodensee auf 15 Euro pro Sack (100 Kilo).
Für zertifizierte Bio-Qualität gab es 20 Euro. 2024 brachte eine nochmalige leichte Verbesserung. Im laufenden Jahr liegen die Preise gemäß einer SÜDKURIER-Umfrage unter Saft-Keltereien am Bodensee und am Hochrhein etwa auf dem Niveau des Vorjahres.
Konkret: Für normales Streuobst zahlen viele Press-Betriebe 16 Euro pro Doppelzentner. Die Notierungen für Bio-Qualität liegen bei bis zu 25 Euro pro Sack. Und im Lauf der Ernte-Saison steigen die Preise normalerweise noch an. Die Preise in Südbaden liegen damit in etwa auf dem Niveau der schwäbischen Landesteile Baden-Württembergs.
Was zahlen die Marktführer?
Die größten Kelterei-Betriebe am Bodensee sind die Dreher-Group aus Stockach und die Bodensee-Kelterei Widemann aus Bermartingen. Beide spielen auch im internationalen Saftgeschäft mit und unterhalten zum Teil Produktionsbetriebe im Ausland. Durch die Verarbeitung besonders hochwertiger Streuobst-Direktsäfte versuchen sie sich von Wettbewerbern im Billigsaft-Segment zu differenzieren.
Über Preise geben beide Unternehmen keine Auskunft. Brancheninformationen zufolge zahlen die Groß-Keltereien 2025 aber vergleichsweise viel fürs Obst. Sowohl die Keltereien Dreher als auch Widemann, zu der auch die Marken Schlör in Radolfzell und Lindauer gehören, zahlen bei Anlieferung frei Hof aktuell 16 Euro je hundert Kilo Äpfel. Für Bio-Qualität legen beide Betriebe 25 Euro je Sack auf den Tisch – allerdings nur, wenn der Anlieferer die teure Bio-Zertifizierung selbst trägt.

Warum sind die Marktpreise gestiegen?
Die Großkeltereien verfolgen seit Jahren eine Internationalisierungsstrategie. Neben Obst aus der Region setzten sie auf EU-weite Obstimporte. Das dominierende Anbaugebiet im europäischen Saftgeschäft ist Polen, wo etwa jeder dritte europäische Apfelbaum steht.
Die Ernten dort fallen aber seit Jahren schlecht aus. In diesem Jahr hätten Fröste im Mai in Polen zu Einbußen bei Streuobst von etwa 30 Prozent gegenüber dem langjährigen Mittel geführt, sagt etwa Jörg Hilbers, Geschäftsführer der Fachgruppe Obstbau der deutschen landwirtschaftlichen Verbände dem SÜDKURIER.
Die Ernten in anderen Obst-Export-Ländern wie Frankreich seien noch unsicher, sagt der Fachmann. Weil internationale Quellen wegfallen, werden auch für die Groß-Keltereien kleine Lieferanten wichtiger. Die Folge: Sie bieten wieder mehr Geld auch für das heimische Streuobst.

Wie viel zahlen die kleineren regionalen Keltereien für das Obst?
Auch die Regio-Betriebe haben nach mehreren schlechten Erntejahren ein Interesse daran, sich die nötigen Obstmengen für ihre Saftproduktion zu sichern und ziehen bei den Preisen nach. Keltereien wie Auer Obstsäfte aus Mühlhausen-Ehingen im Hegau, Weinmann-Fruchtsäfte aus Steißlingen oder Knill aus Oberteuringen nahe Friedrichshafen zahlen 16 Euro pro Hundert-Kilo-Sack. Bei Weinmann gibt es 25 Euro für selbst zertifizierte Bio-Ware.
Sowohl Auer-Geschäftsführer Andreas Bohnenstengel als auch Weinmann-Chef Michael Weinmann halten es für möglich, dass die Obstpreise im Lauf der Erntephase noch ansteigen. Die für Spezialitäten wie Brisanti-Limonade oder Birnoh-Likör bekannte Streuobstmosterei in Stahringen bietet ihren Kunden einen Mindestpreis von 20 Euro pro Doppelzentner Bio-Streuobst – Äpfel wie Birnen.
Wer sortenrein anliefert, bekommt etwas mehr. Mit der Schlussrechnung am Ende der Saison erhalten dann alle Lieferanten nochmals einen Aufschlag, der sich nach der Marktpreisentwicklung richtet. Mit Streuobst-Versorgungsengpässen, wie sie vergangenes Jahr rund um den Bodensee aufgetreten sind, rechne man dieses Jahr aufgrund einer recht günstigen Witterung nicht, sagte Mosterei-Gründer Günther Schäfer dem SÜDKURIER.
Wie sieht es am Hochrhein aus?
Bedeutende Streuobst-Bestände ziehen sich auch entlang des Rheins Richtung Basel. Das Preisniveau liegt dort leicht unter den am Bodensee gezahlten Tarifen. Die in Klettgau ansässige Kelterei Ebner startet beispielsweise mit 14 Euro je hundert Kilo Äpfel in die Saison, 22 Euro gibt es für Bio-Ware. Die Preise würden aber steigen, „sobald die Qualität stimmt“, sagt Susanne Kaiser von Ebner-Fruchtsäfte.







