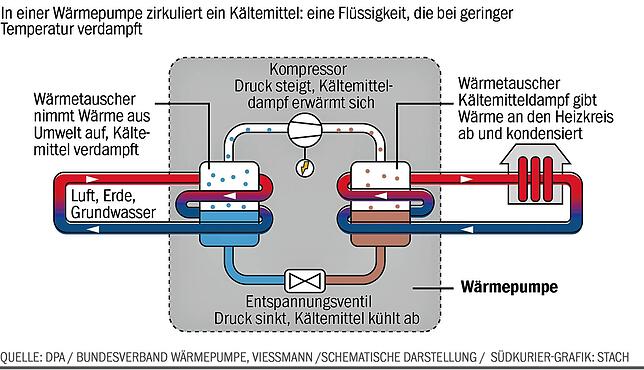Herr Miara, haben Sie selbst eine Wärmepumpe im Keller?
Ich habe seit etwa zehn Jahren eine Wärmepumpe in meinem Haus. Sie tut seither genau das, was sie tun soll. Und zwar mir günstig Wärme und warmes Wasser bereitstellen.
Welche Voraussetzungen haben Sie?
Das Haus ist ganz gut gedämmt. Und es hat eine Fußbodenheizung.
Ist die Fußbodenheizung ein wichtiges Kriterium für eine Wärmepumpe?
Nein, das ist heute nicht mehr entscheidend. Die Technologie ist so, dass sie sich in den meisten Fällen problemlos auch in ein Ein- oder Zweifamilienhaus mit normalen Heizkörpern einbauen lässt.

Das heißt, die Wärmepumpe ist nicht nur etwas für Neubauten?
So ist es. Ich würde sagen, in Neubauten gibt es fast keine echten Alternativen mehr für die Wärmepumpe. Mit Blick auf Komfort, Effizienz und auch was die Betriebskosten angeht, ist sie unschlagbar.
Und im Gebäudebestand?
Beim Fraunhofer ISE machen wir seit ungefähr seit 15 Jahren Studien zu dem Thema. Dafür untersuchen wir die Heizsysteme direkt in den Häusern. Und es zeigt sich, dass die Wärmepumpen in Bestandsimmobilien effizient und vernünftig in der Lage sind, zu arbeiten. Und ich rede da von Häusern, die nicht mehr Stand der Technik sind, also die nicht oder nur teilsaniert sind.
In wie viel Prozent der Altbauten funktioniert die Wärmepumpe?
Grob würde ich sagen, in drei von vier Häusern. Wobei man sagen muss, dass technisch heute fast alles möglich ist, es dann möglicherweise aber nicht immer sinnvoll ist.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Auch Häuser mit sehr schlechter Bausubstanz lassen sich per Wärmepumpe beheizen. Der Grund ist, dass die Systeme heute Vorlauftemperaturen von rund 75 Grad Celsius bringen. Das reicht auch, um eine nicht sanierte Bude warm zu kriegen. Die andere Frage ist dann aber, wie effizient so etwas noch ist, denn klar ist: Je höher die Vorlauftemperatur, desto geringer der Effizienzvorteil der Wärmepumpe. Da lohnt sich also vor dem Einbau eine energetische Sanierung.
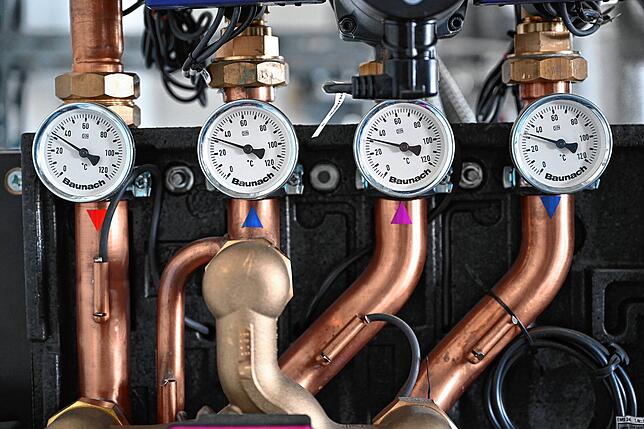
Wer mit Wärmepumpe heizt, ist voll von Strom abhängig. Manche Menschen fürchten daher Blackouts. Können Sie das nachvollziehen?
Ich glaube, dass diese Angst irrational ist. Stromausfälle über Tage sind in Deutschland auch in Zukunft höchst unwahrscheinlich. Und wenn der Strom über Stunden ausfällt, was auch quasi nie vorkommt, sind die Speichermassen in der Gebäudehülle noch so groß, dass man nicht viel merken wird. Das ist dann eher ein Problem fürs Kochen oder Waschen.
Wer trotzdem auf Teufel komm raus für den Extremfall vorsorgen will, sollte sich einen Holzofen anschaffen, denn auch Öl-, Pellet- oder Gasheizungen bleiben meist bei Stromausfall kalt, weil die Regelungselektronik versagt. Ich selbst habe auch einen Kaminofen zu Hause, aber nur aus Komfort- und Nostalgiegründen. Er ist fünf Mal im Jahr in Betrieb.
Stromdirektheizungen in Verbindung mit einer PV-Anlage und einem Speicher gelten als eine Alternative zur Wärmepumpe. Was halten Sie davon?
Der Charme dieser Lösung basiert darauf, dass sie technisch relativ einfach und zu moderaten Kosten realisierbar ist. Außerdem ist die Wärme sofort spürbar. Eine Wärmepumpe braucht da einfach länger. Allerdings ist sie übers Gesamtsystem betrachtet drei bis fünf Mal effizienter. Anders ausgedrückt: Je öfter die Heizung läuft, desto günstiger wird die Wärmepumpe im Vergleich.

Ist Effizienz überhaupt ein Kriterium, wenn man auf dem Dach Sonnenstrom en masse produziert?
Die Krux bei allen diesen Heizlösungen ist, dass der Sonnenstrom zum Heizen im Winter nicht voll zur Verfügung steht. Man muss dann also Strom vom Energieversorger zukaufen. Und dann ist Effizienz wichtig, weil sie die Menge der zugekauften Energie reduziert. Deutschlandweit betrachtet geht es künftig auch darum, Strom zu sparen, sonst werden wir die in allen Sektoren steigenden Strombedarfe gar nicht decken können. Auch deswegen bin ich für die Wärmepumpe.
Wann amortisiert sich eine Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasheizung?
Schwer zu sagen, weil man immer Annahmen treffen muss, deren Eintrittswahrscheinlichkeit unsicher ist. Ganz grob: Bei aktuellen Energiepreisen beträgt der Kostenvorteil einer Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus gegenüber einer Gasheizung etwa 600 Euro pro Jahr, also 12.000 Euro in 20 Jahren. Aber das sind am Ende alles Zahlenspiele, weil die Energiepreise volatil sind. Ich persönlich glaube, der Vorteil der Wärmepumpe wird künftig eher größer ausfallen.

Ist da die Förderung von bis zu 70 Prozent für die Wärmepumpe schon eingerechnet?
Nein, das ist eine reine Betriebskostenrechnung. Die Förderung kommt da noch einmal oben drauf.
Wie sichert man sich gegen das Risiko steigender Strompreise ab?
Gegenfrage: Können Sie sich gegen steigende Öl- und Gaspreise absichern?
Eher nicht.
Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gaspreise steigen werden, ist deutlich höher als bei den Strompreisen. Bei Öl und Gas spüren wir schon heute die Aufschläge durch die CO2-Bepreisung. Und diese werden stetig steigen.
Die Strompreise lassen sich dagegen in gewissem Umfang beeinflussen. Etwa indem man zu einem günstigen Versorger wechselt oder die Last in Zeiten verschiebt, in denen Strom günstig ist. Solche Preismodelle werden bald in der Breite kommen. Außerdem lässt sich mit Stromspeichern im Haus auch einiges ausrichten.
Was ist heute ein angemessener Preis für eine schlüsselfertige Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus?
Ich würde sagen, das liegt irgendwo zwischen 25.000 und 35.000 Euro.
Warum ist das so teuer? Die Nachfrage ist derzeit gering. Da müssten die Preise doch einbrechen?
Deutschland hat die höchsten Preise in Europa, direkt nach der Schweiz. Ein Grund ist, dass die Deutschen generell auf sehr hochpreisige Marken und Modelle setzen. Viele haben eine S-Klasse im Garten stehen. Andere Nationen begnügen sich mit weniger.
Dazu kommt, dass die Handwerker teurer sind als anderswo, was sich aber etwa über höhere Anforderungen des Gesetzgebers oder auch über höhere Lohnkosten rechtfertigen lässt. Übrigens kostet es in Deutschland auch drei bis vier Mal mehr als in England, wenn man sich einen neuen Gaskessel einbaut. Hohe Preise sind also kein generelles Problem nur der Wärmepumpe.

Immer wieder sickert durch, dass Handwerker bei der Installation weit über Gebühr zulangen. Wie unterscheidet man seriöse und unseriöse Anbieter?
Ich drücke es mal so aus: Bestimmt kalkuliert das Handwerk gerade nicht an der unteren Schmerzgrenze. Mein Eindruck ist, dass viele die Möglichkeiten, die ihnen der überhitzte Wärmepumpen-Markt im Jahr 2023 eröffnet hat, möglichst lange fortschreiben wollen. Die Frage ist, wie lange die Endkunden das mitmachen und wann sie anfangen, Preise zu vergleichen und zu verhandeln.
Das Handwerk ist auch aus anderer Sicht entscheidend. Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen gut und schlecht eingebauten Wärmepumpen. Was kann der Endkunde tun?
Das stimmt. Wie gut die Anlage ist, bestimmt der Hersteller. Aber wie effizient sie am Ende läuft, das bestimmt der Handwerker, der sie einbaut. Bei Planung, Installation und auch bei der Einstellung können die Handwerker sehr viel richtig, aber auch falsch machen. Es kommt vor, dass sie die Anlage beispielsweise auf den Werkseinstellungen belassen. Das ist aber nie ideal, weil jedes Haus anders ist.
Wenn man den Handwerksbetrieb also nicht kennt, kommt man als Hausbesitzer nicht drumherum, sich selbst zu informieren und im Zweifel kritisch nachzufragen und den Installateuren auf die Finger zu schauen. Wichtig ist auch, mit den Handwerkern zu reden und klar zu sagen, was man will. Mehr Komfort oder mehr Effizienz? Entsprechend kann die Anlage dann eingestellt werden.
Auf was muss ich bei einer Wärmepumpe noch achten?
Geräuschentwicklung ist insbesondere bei Luft-Wärmepumpen ein Thema. Es gibt da je nach Anlage noch große Unterschiede. Diesbezüglich lohnt es sich, sich zu informieren. Wer in die Zukunft investieren will, sollte eine Wärmepumpe wählen, die Propan als Kältemittel nutzt. Das ist umweltfreundlich und kommt immer stärker.
Geht Deutschland bei der Wärmepumpe eigentlich einen Sonderweg?
Provokativ ausgedrückt geht Deutschland einen Sonderweg, weil wir so wenige Wärmepumpen nutzen. Bei der Anzahl der Anlagen pro Einwohner liegt Deutschland in der EU weit hinten. In Skandinavien gibt es bis zehn Mal so viele Anlagen pro 1000 Einwohner. In Frankreich, Italien und Holland sowieso. Wir sind also ziemlich langsam unterwegs.