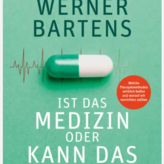Herr Bartens, haben Sie noch Ihre Mandeln im Rachen?
Nein, meine Mandeln wurden mir vor der Einschulung herausoperiert, weil ich als Kind keine Tabletten schlucken konnte. Obwohl ich sonst keine Probleme hatte und nicht häufig unter Halsschmerzen litt. Als Mediziner weiß ich heute, dass das völlig unnötig war. Die Mandeln haben eine wichtige Funktion fürs Abwehrsystem. Die Wahrscheinlichkeit für Atemwegserkrankungen, Infektionen und allergisches Asthma steigt, wenn die Mandeln entfernt werden. Obwohl die Leitlinien längst geändert wurden, werden die Operationen bis heute viel zu häufig durchgeführt, absurderweise in manchen Landkreisen Deutschlands vier- bis fünfmal so häufig wie in anderen.
Was ist der Grund, dass man schon bei Kindern voreilig zum Skalpell greift?
Viele Ärzte und Kliniken handeln aus falscher Gewohnheit, überkommenen Ritualen und operieren wegen finanzieller Fehlanreize zu häufig. Gaumenmandeln sollten erst dann operiert werden, wenn man mehr als sechsmal im Jahr an bakteriellen Halsentzündungen erkrankt, die tatsächlich mit Antibiotika behandelt werden müssen. Aber das ist schon das nächste Problem: Kindern wie Erwachsenen werden viel zu schnell Antibiotika verschrieben.

Fachleute sprechen hier von Überversorgung. In einer Überflussgesellschaft klingt das vielleicht nicht bedrohlich. Aber ist das gesund?
Überversorgung ist extrem ungesund. Der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen warnt seit Langem davor, dass die Überversorgung eine der größten Gefahren der Medizin für Patienten in wohlhabenden Ländern ist. Zum einen droht konkreter körperlicher Schaden, wenn man unnötig operiert wird, unnötig Medikamente nimmt oder Röntgen- und Strahlenbelastung ausgesetzt wird. Doch genauso wenig sollte man eine andere Gefahr vernachlässigen: Überversorgung führt zu einer flächendeckenden Krankrederei. Wenn Diagnosemethoden immer genauer werden, entdeckt man viel leichter Abweichungen von der Norm. Dann heißt es: Na ja, wir haben da was gefunden. Ist nicht schlimm, aber wir müssen es kontrollieren. Damit wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der uns alle nur noch gesund auf Probe sein lässt.
Nennen Sie uns ein Beispiel?
Wissenschaftler in der Schweiz machten einmal für eine Studie ein Experiment: Sie legten Radiologen und Orthopäden hunderte Röntgenbilder und CT-Aufnahmen vor, ohne ihnen zu sagen, dass sie von gesunden Studenten stammten, die über keinerlei Rückenbeschwerden klagten: Doch die Mediziner stellten anhand der Bilder in mehr als einem Drittel der Fälle die Diagnose, dass man wegen sichtbarer Anomalien dringend operieren müsse. Sie waren sich sicher, dass die Betroffenen starke Schmerzmittel nehmen. Das waren keine schlechten Ärzte, aber was man auf den Röntgenbildern sieht, entspricht häufig nicht dem, wie sich die Menschen fühlen. Es gibt einen Unterschied zwischen Befinden und Befunden.
Gilt dies auch umgekehrt: dass erst der Befund krank macht?
Wenn mir der Arzt sagt, ich habe da was, ändert sich auch mein Befinden. Man kauft sich neue Matratzen, rennt zur Physiotherapie und lässt sich, wenn es ganz schlimm läuft, operieren. Für die meisten akuten Rückenschmerzen gilt aber, was der bekannte deutsche Orthopädie-Professor Peer Eysel sagt: „Mit Behandlung 14 Tage – ohne zwei Wochen.“ Das ist in unzähligen Studien belegt. In 90 Prozent der Fälle verschwinden Rückenschmerzen von allein. Natürlich gibt es auch schwere Erkrankungen. Aber viel häufiger spielen psychische Faktoren eine Hauptrolle bei Rückenschmerzen. Das ist kein ominöses seelisches Rätsel. Zwischen Ängsten und schlechter Stimmung auf der einen Seite und Schmerzen oder auch Krankheiten wie Herzinfarkten auf der anderen gibt es klare neurobiologische Zusammenhänge. Das Schmerzzentrum ist eng mit jener Hirnregion verknüpft, die Wohlbefinden oder Missstimmung registriert.
Wird in Deutschland grundsätzlich zu viel operiert?
Deutschland ist Weltmeister bei Herzkatheter-Eingriffen, beim Einsetzen künstlicher Hüft- und Kniegelenke, bei vielen Rücken-Operationen und beim Röntgen von Rücken. In Schweden, Finnland und Norwegen werden pro Einwohner ein Drittel bis die Hälfte weniger Herzkatheter-Untersuchungen gemacht, dennoch haben die Menschen dort eine höhere Lebenserwartung. Nirgendwo werden mehr Stents in Herzkranzarterien implantiert als in Deutschland, ohne dass die Menschen deshalb länger von Infarkten oder Komplikationen verschont blieben als in anderen wohlhabenden Ländern.
Geht es uns am Ende dennoch besser?
Bei der Lebenserwartung ist Deutschland unter den industrialisierten Ländern nicht führend, sondern nur unteres Mittelfeld. Auch die Müttersterblichkeit ist in Deutschland doppelt so hoch wie in Skandinavien. Das hat möglicherweise auch damit zu tun, dass es bei uns doppelt so viele Kaiserschnitt-Operationen gibt wie in Finnland, Norwegen und Schweden. In Deutschland werden heute bei zwei Drittel aller werdenden Mütter „Risikoschwangerschaften“ diagnostiziert, was bei den Frauen zu Angst und bei Ärzten zu einer Absicherungsmedizin führt.
In Ihrem Buch gehen Sie kritisch mit Vorsorgeuntersuchungen wie der Mammografie ins Gericht. Warum?
Aus heutiger Sicht hätte man das flächendeckende Mammografie-Screening nicht einführen müssen, weil das Nutzen-Risiko-Verhältnis nicht eindeutig positiv ausfällt. In sehr vielen Studien hat sich gezeigt, dass wenn Frauen im Alter zwischen 50 und 70 zehn Jahre lang alle zwei Jahre zur Mammografie gehen, dann sterben in den kommenden zehn Jahren drei von tausend an Brustkrebs. In der Gruppe, die nicht zur Mammografie geht, sterben daran auch nur vier von tausend. Der Nutzen ist also gering. Doch gleichzeitig werden 150 Fehlalarme bei tausend Frauen mit der falschen Diagnose Brustkrebs ausgelöst, obwohl kein Tumor vorliegt. Das löst bei den Betroffenen große Angst und Verunsicherung aus. Einige von ihnen werden sogar bei unklarem Befund unnötig operiert.
Was kann man als Patient tun, um nicht Opfer von Überversorgung zu werden?
Ich will auf keinen Fall raten, mit Misstrauen in die Praxis zu gehen, im Gegenteil, wir haben sehr gute Ärzte. Ich rate jedem, vor dem Arztbesuch aufzuschreiben, was man wissen will und erst wieder zu gehen, wenn man alle Antworten auch verstanden hat. Es ergibt auch keinen Sinn, sich eine zweite Meinung einzuholen, wenn man die erste nicht verstanden hat. Bei Untersuchungen, Eingriffen und Behandlungen kann man die Ärzte fragen, ob sie diese auch für sich selbst oder ihre Liebsten machen lassen würden und welche Alternativen es gibt. Man sollte auch nicht verheimlichen, wenn einen psychische Belastungen quälen.
Werner Bartens: Ist das Medizin – oder kann das weg? Verlag Gräfe und Unzer; 224 Seiten, 19,99 Euro.