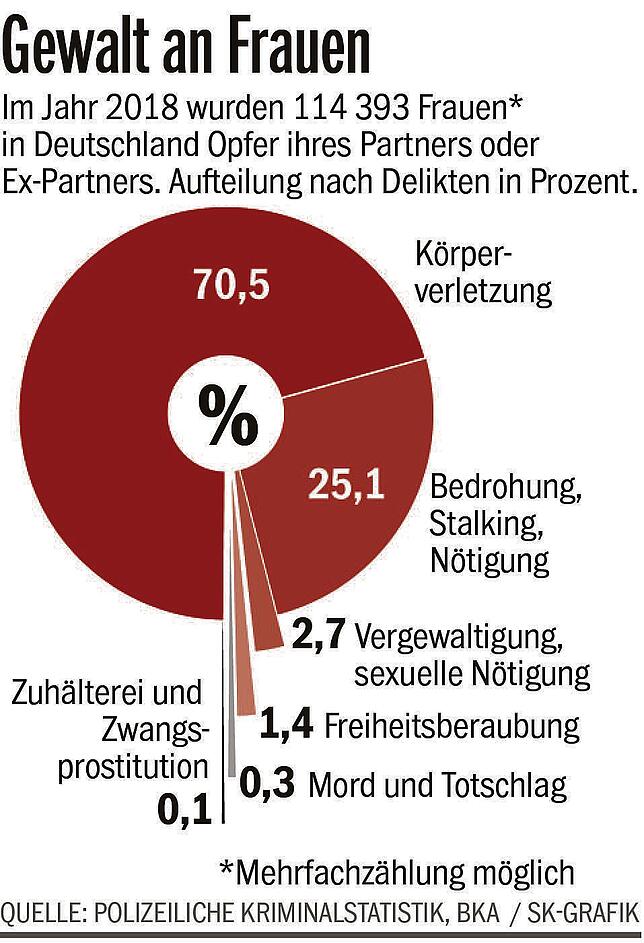„Als es passiert ist, dachte ich, ich muss sterben.“ Elsa, eine 44-jährige Frau mit einem freundlichen runden Gesicht, meint das ganz wörtlich. Als sie ans Sterben dachte, lag sie eingeklemmt zwischen Schrank und Bett im eigenen Schlafzimmer und ihr Mann schlug mit beiden Fäusten auf sie ein.
Sie flehte ihn an, den Krankenwagen zu rufen, und schließlich gab er nach. Sie hatte ihm versprochen, ihn nicht zu verraten. Eine Notlüge, größer kann die Not kaum sein.
„Solange er für die Familie sorgt, ist es in Ordnung“
Elsas Blutergüsse sind inzwischen verheilt, aber am Kopf, wo sie ihr Mann an den Haaren gezogen hatte, ist noch eine kahle Stelle zu sehen. Allmählich schöpft sie wieder Selbstvertrauen. Dabei hilft ihr die Gemeinschaft im Singener Frauenhaus, in dem sie seit zwei Monaten lebt.
Die Frauen reden viel, kochen gemeinsam und überlegen sich, wie ihr Leben weitergehen soll. Mit ihrem Mann, mit dem sie Anfang der 90er-Jahre den Kosovo verließ, hat sie seither nicht geredet. Die 23 Jahre Ehe waren nicht immer gut, aber die Tradition gebot es, auf den Mann zu hören. „Solange er für die Familie sorgt, ist es in Ordnung“, fasst Elsa das Eheverständnis zusammen.
Viele böse Worte und einige Schläge ertrug sie. Vor einem Jahr aber wurde er arbeitslos, zahlte die Rechnungen nicht mehr, kümmerte sich um nichts. Da war Elsa nicht mehr bereit, alles über sich ergehen zu lassen.
Es gibt Frauen, die bereits nach der ersten Gewalterfahrung, bei der Beratungsstelle anklopfen. Häufig aber liegt, wie bei Elsa, schon ein Prozess der Demütigungen hinter ihnen, weiß Claudia Zwiebel, Geschäftsführerin von Frauen & Kinderschutz e.V. Singen, zu dem das Frauenhaus gehört.
Anlass für den Beziehungsabbruch, sei dann häufig, dass er auch noch die Kinder verprügelt, der Frau den Kontakt zu Freunden verbietet, oder ihr Geld ausgibt.
Beim ersten Mal die Koffer packen
Alina, 27, stammt aus Südosteuropa, mit Mann und Kindern lebte sie in Norddeutschland. Dort hat sie in wenigen Jahren gut deutsch gelernt, an ihre Sätze hängt sie meist ein bekräftigendes „ne“. Alina hat den Kreditvertrag für das gemeinsame Haus unterschrieben, und fleißig renoviert hat sie obendrein, im Grundbuch aber steht sie nicht.
Das Singener Frauenhaus wurde zu ihrer dritten Frauenhaus-Station, weil sie Distanz schaffen wollte zwischen sich und ihrem Mann und weil sie in der Gegend Familie hat. Die ersten beiden Male ging sie zu ihm zurück: „Ich habe gedacht, es wird besser.“
Aber besser wurde es nicht. Und wird es in der Regel nicht. Claudia Zwiebel rät deshalb auch dazu, bereits beim ersten Mal die Koffer zu packen. „Das ist wie bei einem Hund, der einmal zugebissen hat: Wenn ich über diese Schwelle gegangen bin, ist die Gefahr, dass es wieder passiert, ziemlich groß“, sagt die Diplom-Sozialwissenschaftlerin.

Elsa und Alina heißen in Wirklichkeit anders. Zu groß ist das Risiko, erkannt zu werden. Die Adresse des Singener Frauenhauses ist geheim. Ungebetenen Besuch hatten die Bewohnerinnen dort trotzdem schon. 2018 versuchten zwei Männer, sich Zutritt zu verschaffen.
Seither sorgen ein Tor und eine dicke Tür für mehr Sicherheit. Fünf Frauen und zehn Kinder finden hinter dieser Tür derzeit Zuflucht. Dabei verfügt das Frauenhaus nur über zehn Betten. Will noch jemand aufgenommen werden, kann Claudia Zwiebel nur noch auf ihr Netzwerk an Frauenhäusern in Baden-Württemberg verweisen.
Auch die Bürgermeistergattin ist betroffen
Alina und Elsa sind beide Migrantinnen, wie ein Großteil der Bewohnerinnen des Singener Frauenhauses. Dabei ist Gewalt kein ausländisches Phänomen. Die meisten Schläger haben die deutsche Staatsangehörigkeit, sagt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). „Die Gewalt geht durch alle sozialen Schichten und alle ethnischen Gruppen“, sagt auch Dorothea Wehinger, grüne Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Singen und frauenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion.
In der Beratungsstelle von Frauen- und Kinderschutz Singen e.V. ist das gesamte soziale Spektrum vertreten: Es gibt auch die Bürgermeistergattin, der ihr Mann die Eröffnung eines Kontos unmöglich macht, weil er überall herumerzählt, seine Frau sei psychisch krank.
Ins Frauenhaus ziehen die Frauen aus besseren Verhältnissen in der Regel allerdings nicht. Sie kommen bei den Eltern oder bei Freunden unter, oder sind finanziell unabhängig genug, um vorübergehend im Hotel zu wohnen. Im Frauenhaus kommen eher die Frauen an, die keine andere Wahl haben.
Die Bundesregierung hat im November versprochen, mehr gegen Gewalt an Frauen zu tun. Mit einem Förderprogramm will Giffey ab 2020 120 Millionen Euro in Beratungsstellen und Frauenhäuser stecken. Doch ob davon auch genug in Singen ankommt?
Drei Leute teilen sich 2,4 Stellen
Brauchen könnten sie es. Drei Leute teilen sich 2,4 Stellen – für Beratungsstelle, Nachbetreuung, Krisenintervention und Wohnprojekt. Das Geld kommt vom Landkreis, vom Regierungspräsidium und der Aktion Mensch – und es ist meist zu wenig.
Auch die Ankündigung der Landesregierung, für die Versorgung gewaltbetroffener Frauen im Haushalt 2020/21 zwölf Millionen Euro mehr vorzusehen, beruhigt die Sozialverbände nicht. „Trotz dieser Erhöhung wird Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich immer noch zu den Schlusslichtern gehören“, schreibt der Paritätische in einem Brandbrief an Finanzministerin Edith Sitzmann.
Legt man die Maßstäbe der Istanbul-Konvention an, ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen, fehlen laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband allein im Südwesten 2000 Frauenhausplätze. Das Land rechnet anders: Es geht von 633 fehlenden Plätzen aus.
Vorhanden sind aktuell 341 Plätze für Frauen und 411 Plätze für Kinder in den 42 vom Land geförderten Frauenhäusern. Die sind allerdings nicht gleichmäßig übers Land verteilt, im Landkreis Rottweil etwa gibt es noch kein Frauenhaus, im Landkreis Konstanz dagegen drei.
„Kein Ausdruck von Ohnmacht, sondern einer von Macht“
Investiert wird vom Land in neue Frauenhäuser – vorausgesetzt, die Kommunen beteiligen sich -, in Beratungsstellen und in Präventionsarbeit. „Von klein an einüben: Wie gehe ich mit andern Menschen um?“ Dorothea Wehinger ist das besonders wichtig. Wünschen würde sich die Grüne aber noch etwas anderes: dass man sich mit den Tätern beschäftigt. In einem Flüchtlingscamp in der Türkei, das sie besuchte, gebe es Workshops, bei denen die Männer lernen, wie sie mit ihrer Gewalt umgehen können. „Das hat mir sehr imponiert.“ Claudia Zwiebels Mitgefühl mit den Schlägern hält sich in Grenzen: „Tatsache ist, dass Gewalt kein Ausdruck von Ohnmacht ist, sondern einer von Macht: Sie ist ein Mittel, den eigenen Willen durchzusetzen.“
Wie geht es mit Elsa und Alina weiter? In der Regel bleiben die Bewohnerinnen drei bis vier Monate im Frauenhaus. Bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen können. Elsa hat Kraft geschöpft. Sie sagt, sie will ihr Leben genießen. Alina scheint noch nicht soweit. Hat sie mit ihrem Mann wirklich abgeschlossen? Die Schuld an seinen Ausrastern gibt sie ihrer Schwiegermutter.