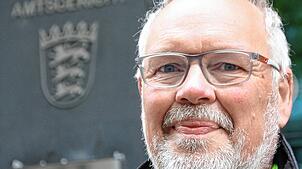Das Problem ist einfach erklärt. Deutschland benötigt mehr Blut für Operationen und Transfusionen als zur Verfügung steht. Deswegen forschen Wissenschaftler weltweit an einer Lösung. Auch an der Uni Konstanz hat sich ein Forschungsteam gebildet, das menschliches Blut im Labor herstellt. Geleitet wird es von Julia Gutjahr. Die promovierte Molekularbiologin kommt aus Österreich und hat in Linz und Salzburg studiert. Fünf Jahre hat sie sich danach an der Queen Mary University in London mit dem Thema Blutkrebs beschäftigt.
Ihre Leidenschaft für Biologie war schon in ihrer Kindheit zu erkennen. “Ich war schon immer an der Natur interessiert, habe als Kind gerne Fische seziert“, sagt Gutjahr. Sie wollte aber auch den Menschen helfen, zum Beispiel ihrer an Migräne leidenden Mutter. So kam die Idee, Forscherin zu werden. “Besonders reizt mich, dass ich Experimente mache, die noch nie zuvor gemacht wurden.“
Über einen Kollegen wurde Gutjahr vor zwei Jahren auf die Möglichkeit aufmerksam, am Institut für Zelluläre Biologie und Immunologie Thurgau mit Sitz in Kreuzlingen, einem sogenannten An-Institut der Uni Konstanz, zu arbeiten. Das Geld für die Forschung kommt von einer Stiftung aus der Schweiz, Julia Gutjahr und ihre Kollegen nutzen aber die Möglichkeiten der Konstanzer Uni. Im Gegenzug dürfen Studierende am Institut Seminare besuchen und ihre Abschlussarbeiten dort schreiben.
15.000 Blutkonserven werden in Deutschland täglich gebraucht. Die Spender reichen aber immer weniger aus. Nur etwa drei Prozent der Bevölkerung spendet Blut. Gutjahr und ihre Forschungsgruppe haben vor kurzem einen wichtigen Fortschritt erzielt, der die Situation signifikant verbessern könnte: “Wir haben entdeckt, dass das Protein CXCL12 den Zellausstoß zur Produktion roter Blutkörperchen triggern kann“, sagt Gutjahr.
Der Grund für den Ausstoß war bisher noch unbekannt. Im Labor werden die Zellen schon jetzt künstlich mit CXCL12 behandelt. “Damit können wir die Erfolgsquote für die Blutherstellung auch bei normalen Körperzellen deutlich erhöhen.“
Die Entdeckung hat Julia Gutjahr und ihrem Team schon weit über die Universität hinaus Anerkennung und Angebote zur Zusammenarbeit eingebracht. Ihre Erkenntnisse zu teilen, ist für die Wissenschaftlerin kein Problem, im Gegenteil: “Ohne eine internationale Zusammenarbeit geht es nicht. Wir arbeiten im Endeffekt ja nicht für uns, sondern für die breite Masse.“
Noch ist die Produktion aber sehr aufwändig und deswegen auch teuer. “Die Vorläuferzellen sind kleine Diven, sie brauchen ständig neue Nährstoffe.“ Und die benötigten Mengen sind enorm. Für einen Mikroliter Blut werden eine Milliarde roter Blutkörperchen benötigt. Selbst in den besten Laboren kostet das Tausende Euro. “Blutspenden sind deswegen weiterhin sehr wichtig. Aber gerade für spezielle Behandlungen wie Transfusionen wird Laborblut eine Rolle spielen“, sagt Gutjahr. Außerdem könnten damit gezielt seltene Blutgruppen hergestellt, Engpässe überbrückt oder das eigene Blut reproduziert werden, um spezielle Behandlungen zu ermöglichen.
Mit ihren ehemaligen Kollegen aus London steht sie regelmäßig in Kontakt. So gerne sie auch dort an der Queen Mary University war, sie zieht die Forschung in der Bodenseeregion vor. “Als kleines Institut sind wir auf die Unterstützung aus der Region angewiesen“, sagt Gutjahr. Das Knochenmark für die Forschung erhält das Team aus Krankenhäusern in der Region. “In London war es unmöglich, Stammzellen zu bekommen. Man kennt die Menschen hier einfach viel schneller.“
Neben den beruflichen Vorteilen ist die Österreicherin auch privat am Bodensee heimisch geworden. “Die Lebensqualität ist hier natürlich gigantisch. Meine Familie und ich lieben den See und die Nähe zu den Bergen.“ Noch sechs Jahre läuft das Projekt und somit auch der Beitrag der Uni Konstanz für internationale Spitzenforschung.