
Nebel – so dicht, dass er alles einhüllt und in ein düsteres Licht taucht: Gassen, Boote, Menschen. Ein gewohntes Bild für die Bewohner der Bodenseeregion in Herbst und Winter. Manchen wird es ob dieser schaurigen Stimmung schwer ums Herz.
Können sie bald aufatmen? Ein Blick in die Messdaten der DWD-Wetterstation Konstanz seit 1980 zeigt nämlich eine klare Tendenz zu weniger Nebelstunden pro Jahr.
Deutlich wird: Während in den 1980er-Jahren 400 oder gar 600 Nebelstunden im Jahr die Normalität waren, werden diese Werte seit 2000 kaum noch erreicht. Fünfmal gab es seither sogar weniger als 200 Nebelstunden im Jahr am See.
Der Bodensee als Quelle für Nebel
Grundsätzlich ist die Bodenseeregion für Nebel geradezu prädestiniert, wie Hanns Ulrich Kümmerle vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erläutert. Der Bodensee liege in einem Becken zwischen Alpen, Hegau, Schwarzwald und Schwäbischer Alp, in dem sich vor allem in Herbst und Winter Kaltluft gut sammeln könne, die für die Nebelbildung ausschlaggebend ist.
„Kalte Luft kann weniger Wasserdampf aufnehmen als warme Luft. In Folge der nächtlichen Abkühlung kondensiert irgendwann ein Teil des in der Luft vorhandenen Wasserdampfes“, so DWD-Klimaexperte Kümmerle, der am Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD in Freiburg arbeitet.

Über der großen Wasserfläche des Sees, der im Herbst und Winter oft wärmer sei als die Luft, verdunste viel Wasser. Das fördere die Nebelbildung weiter. „Gleichzeitig sind die Niederungen Süddeutschlands meist windschwache Regionen, was in Kombination mit der zuvor erwähnten Beckenlage den Abtransport des Nebels behindern kann.“ Deshalb sei die Bodenseeregion in Herbst und Winter eine der nebelreicheren Regionen im Südwesten.
Weltweit ist Nebel auf dem Rückzug
Dennoch scheinen die Messdaten aus Konstanz eine Abnahme des Nebels zu belegen. Überrascht ist Kümmerle davon nicht. Denn weltweit gibt es immer weniger Nebel. Das bestätigt auch Otto Klemm. Er ist Professor für Klimatologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und zählt die Nebelforschung zu seinen Schwerpunkten.
„Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen nimmt der Nebel seit Jahrzehnten ab“, so Klemm. Der Grund für den Nebelrückgang: die Klimaerwärmung – und weniger Luftverschmutzung. „Mit Sicherheit spielt beides eine Rolle“, sagt Klemm.
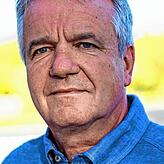
In den vergangenen Jahrzehnten sei die Luft immer wärmer geworden. „Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte.“ Erst bei sinkenden Temperaturen nimmt die relative Luftfeuchte zu, bis sich bei einer Luftfeuchte von etwa 100 Prozent Nebel bilden kann. Warme Temperaturen hingegen bedeuten weniger relative Luftfeuchte und dadurch auch weniger Nebel.
Doch auch wenn Feuchtigkeit vorhanden ist, werden sogenannte Kondensationskerne benötigt, um Nebel zu bilden. Wenn durch Luftverschmutzung viele Kondensationskerne vorhanden sind, ergeben sich viele kleine Nebeltropfen, die das Licht stärker streuen, wodurch die Sichtweite stark eingeschränkt ist. „Wenn weniger Partikel in der Luft sind, da sie sauberer ist, entsteht weniger dichter Nebel“, so Klemm.
Gibt es auch weniger Hochnebel am Bodensee?
DWD-Klimaexperte Kümmerle führt ebenfalls bessere Luftqualität und Klimaerwärmung als Gründe für einen möglichen Nebelrückzug am Bodensee auf. Allerdings mahnt er zu Vorsicht. Denn von Nebel sprechen Meteorologen einzig, wenn die Sichtweite weniger als einen Kilometer beträgt.
„Häufig tritt am Bodensee aber Hochnebel auf. Dann beträgt die Sichtweite in Konstanz vielleicht zwei Kilometer, definitionsgemäß also kein Nebel, und trotzdem ist es draußen grau und trüb und gefühlt neblig“, so Kümmerle. Wobei Hochnebel ein umgangssprachlicher und kein wissenschaftlicher Begriff ist – und streng genommen eben kein Nebel, sondern eine tief liegende Wolke, Stratus genannt.

Ob es auch weniger Hochnebel gibt, sei schwierig zu sagen, so Kümmerle. „Dazu gibt es keine wirklichen Erkenntnisse.“ Man könne sich zwar die Anzahl Sonnentage anschauen, um zu sehen, ob es mehr davon gibt als in früheren Jahren. „Aber auch das ist nur eine Annäherung, denn die Sonne scheint ja auch nicht, wenn es beispielsweise regnet und das Wetter trüb ist.“
Welche Folgen hat der Nebelrückgang?
Dass die Tage, an denen die Sichtweite am See weniger als einen Kilometer beträgt – und damit auch im meteorologischen Sinne Nebel herrscht – im Langzeitvergleich weniger werden, zeigen aber eben nicht nur die Messdaten aus Konstanz. Auch die weltweit gemachten Beobachtungen von Nebelforschern wie Klemm weisen klar in diese Richtung.
Doch was bedeutet es für Mensch und Umwelt, wenn es immer weniger Nebel gibt? Erst einmal sei das natürlich positiv, sagt Klemm. „Zum einen schlägt Nebel ja vielen aufs Gemüt. Und zum anderen wird durch bessere Sicht die Gefahr von Verkehrsunfällen geringer.“
Doch in einigen Weltregionen könnte der Rückgang des Nebels fatale Folgen haben. „In einigen tropischen Bergregionen haben sich Ökosysteme entwickelt, die an Nebel angepasst sind. Für sie ist die Feuchte des Nebels lebenswichtig. Wenn der Nebel nun in höhere Bergregionen wandert, ist das eine Gefahr für die Biodiversität in der ursprünglichen Höhenlage des Bergnebelwaldes.“
In der Bodenseeregion bestehe diese Gefahr jedoch nicht. Und aktuell zeichne sich auch nicht ab, dass der Nebel eines Tages gänzlich verschwinden könnte, betont Klemm.







