Nicole Widmann hat sich diesen Schritt gut überlegt. Die junge Frau aus dem kleinen Denkingen (bei Pfullendorf) ließ sich einen Termin beim Standesamt in München geben, wo sie aus beruflichen Gründen wohnt. Dort wird die 28-Jährige freilich nicht in den Bund der Ehe treten, sondern einen anderen Bund lösen: Sie wird aus der katholischen Kirche austreten, der sie seit 28 Jahren angehört. Seit ihrer Taufe kurz nach der Geburt.
Ihre Entscheidung fällte sie nicht spontan oder im Zorn, berichtet sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das Verlassen einer Traditions- und Glaubensgemeinschaft entspringt keiner Sektlaune. Jemand setzt den Deckel auf den Topf, der sich über die Jahre gefüllt hat. Prall gefüllt.
Die Gründe, die Nicole anführt, haben es in sich. In erster Linie bedrückt sie die Art und Weise, wie die katholische Kirche mit sexuellem Missbrauch in ihren Reihen umgeht. „Die Aufarbeitung verläuft viel zu schleppend“, sagt sie. 2010 wurden die ersten Fälle von sexueller Gewalt publik, damals hieß der Papst noch Benedikt XVI. „Ich habe nicht den Eindruck, dass hier schonungslos aufgeklärt wird“, sagt sie. Das hat sie erschüttert.

„Eine gute Freundin lebt mit einer Frau zusammen“
Auch eine Nachricht der ergangenen Tage hat Widmann bestärkt. Das vatikanische Verbot des Segens für homosexuelle Paare bestätigt, dass sie und ihre angestammte Kirche nicht mehr zusammenpassen. „Eine meiner besten Freundinnen lebt mit einer Frau zusammen“, berichtet sie.
Warum sollen die beiden keine rituelle Wertschätzung erfahren dürfen, rätselt sie. Sie denkt, dass sich diese Kirche nicht auf der Höhe der Zeit bewegt. „Wichtige naturwissenschaftliche Erkenntnisse hat sie nicht akzeptiert“, denkt sie. Homosexualität werde heute anders beurteilt als noch vor 30 Jahren.
In der Hierarchie stehen die Frauen unten
Widmann arbeitet als Personalentwicklerin bei einer mittelständischen Firma in München. Sie ist beruflich mit Personal und Gleichstellung befasst. Sie kennt sich aus im Organigramm einer Firma und weiß, wie man es liest. Umso mehr wundert sie sich über das katholische Frauenbild mit seinem zementierten Status. Sie fasst es so zusammen: „Warum dürfen Frauen nicht Priesterin werden?“ Sie findet kein Argument, das ihr als Laie einleuchtet. „Das ist doch nicht auf der Höhe der Zeit“, entfährt es ihr.

Irgendwann bleibst du weg
Soweit die äußeren Gründe, die mit Kirchenpolitik und Akten zu tun haben. Gravierender dürfte etwas anderes sein, nämlich die schleichende Entfremdung von einer Institution, die früher selbstverständlich war. In Denkingen, 800 Einwohner, war des pfarreiliche Leben früher noch Teil des Dorfes. Nicole feierte dort Erstkommunion und erlebte ihre frühen Jahre dort als Eintauchen in eine große Gemeinschaft. Doch dann wurde Geflecht langsam dünner, es verlor an Bindekraft. Am Ende stand die Einsicht, dass sie das nicht mehr braucht. „Seit Jahren gehe ich nicht mehr in die Kirche“, so beschreibt sie das.
Dazu kommt die Kirchensteuer, bei ihr ein stattlicher zweistelliger Betrag pro Monat. Wofür? „Es geht auch ohne die Institution“, sagt sie. Deutschland sei von christlichen Werten geprägt und das sei ihr auch recht. Aber die Kirche als garantierenden Rahmen, die braucht sie nicht mehr.

Warum fragt keiner nach?
Wie gehen die beiden großen Kirchen damit um? Sie tun sich schwer mit den Abgängen, sehr schwer. Sie reagieren in einer Mischung aus Routine und Aktenvorgang. Die Ausgetretenen sind für die Pfarrämter nicht wirklich greifbar. Da sich die Mitglieder vor dem Staat (Standesamt) und nicht vor ihrer Pfarrgemeinde erklären, geschieht der Austritt unauffällig.
Die Kirchengemeinde vor Ort erfährt erst später davon, wiederum durch eine dürre offizielle Mitteilung. Es ist nicht bekannt, dass diese Abmeldungen nachgearbeitet werden, dass nachgefragt und nachgehakt wird. Sollte das stattfinden, bleibt es diskret.
Der gesamte Vorgang bleibt bürokratisch. Die Daten wandern von einem PC in den nächsten PC, werden sortiert, archiviert, vergessen.
„Auf die Zunahme der Kirchenaustritte reagieren die Kirchen hilflos“, stellte der Schriftsteller Bernhard Schlink vor einem Jahr fest. Schlink schlug deshalb Folgendes vor: Wie wäre es denn, so fragt er sich, wenn der Austritt nicht dem Standesbeamten präsentiert wird, sondern dem Pfarrer? Für seine Idee, die er Anfang 2020 präsentierte, erntete er betretenes Schweigen. Abgewehrt.
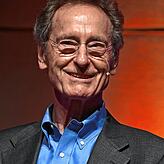
Ein Verlust an Bedeutung
Und die Ursachen? „Sicherlich kann von einem Relevanzverlust von Kirche und Religion gesprochen werden“, sagt Daniel Meier, Sprecher der evangelischen Kirche in Baden. Das gilt unabhängig vom Gesangbuch, es gilt für die evangelische ebenso wie für die katholische Kirche. Das ist das massivste Argument, diese Institution zu verlassen. Wenn sie keine Bedeutung mehr im Leben eines Menschen einnimmt, liegt ein Austritt nahe.
Wegen der Kirchensteuer an sich werde kaum einer austreten, nimmt Meier an. „Wer die Relevanz von Kirche erkennt, sieht auch die Kirchensteuer nicht kritisch“, sagt er. Erst wenn der Glaube keine Rolle mehr im Leben spiele, die Kirche buchstäblich überflüssig sei, reife der Gedanke an ein Verlassen. Die Dienstleistung, die eine Kirche erbringe, werde dann nicht mehr abgefragt.
Was einem Austritt vorangeht
„Wenn wir Menschen erst nach dem erfolgten Austritt ansprechen, ist das eindeutig zu spät“, heißt es im Erzbistum Freiburg. Man müsse früher ansetzen, sagt dessen Sprecher Michael Hertl. Das ist leichter gesagt als getan. Man wolle Mitglieder, die sich nicht mehr zeigen, darauf hinweisen, dass sie mit ihrer Mitgliedschaft auch „sozial Schwächere und gesellschaftlich Benachteiligte solidarisch unterstützen, auch im weltweiten Maßstab.“ Die katholische Kirche kann hier ihre globale Karte ausspielen und damit die Tatsache, dass sie Projekte in ärmeren Ländern massiv unterstützt.
Im Übrigen wirke Glaube auch als eine Art Immunsystem, behauptet Hertl: „Eine Untersuchung der Uni Münster hat gerade erst Hinweise darauf gegeben, dass sozial gelebter Glaube dabei helfen kann, besser durch die Corona-Krise zu kommen.“ Schon deshalb müsse man sich den Gang aufs Standesamt gut überlegen.
Die Kirchensteuern brechen ein
Die Wellen an Kirchenaustritten haben handfeste Folgen. „2020 verzeichneten die Kirche einen Rückgang an Kirchensteuereinnahmen“, sagt Eva Wiedemann für das Bistum Rottenburg-Stuttgart – immerhin eine der reichsten Diözesen in Deutschland. Um 8,2 Prozent gingen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr (2019) zurück, sagt die Sprecherin. In anderen katholischen Bistümern zeichnet sich Ähnliches ab. Die Folgen sind bereits sichtbar, es werden Stellen vor allem im pastoralen Bereich abgebaut.









