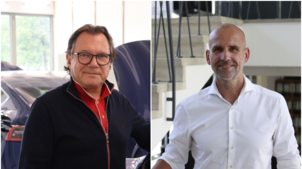Es waren vor allem die Fragen, die Sabine Scheffer-Bulach sehr weh taten. Hätte man "Es" irgendwie verhindern können? War sie schuld, weil sie einem Kaiserschnitt zugestimmt hatte? Oder, weil sie ihre kleine Tochter, damals vor 13 Jahren, erst eine Woche nach der Geburt zu sich nehmen konnte, weil sie dabei fast gestorben wäre?
"Es" – das ist das Defizit von Tochter Lorena, das keinen Namen hat, weil niemand so genau weiß, woher es kommt. Die Symptome? Eine deutliche Entwicklungsverzögerung, Lernbehinderung und Epilepsie. Doch das sieht man dem fröhlichen Mädchen auf den ersten Blick nicht an. Selbst ihre Eltern haben das "Es" lange nicht gesehen.
Sabine Scheffer-Bulach war 22 Jahre alt, als sie ihr zweites Kind bekam. Die Geburt von Sohn Moritz zwei Jahre zuvor war aufgrund seines hohen Gewichts sehr schwer. "Die Ärzte rieten mir danach zu einem geplanten Kaiserschnitt", erklärt die heute 36-Jährige. Sie willigte ein und Tochter Lorena wurde 2005 per Operation zur Welt gebracht.
Blut, Hektik, Vollnarkose: Intensivstation statt Wochenbett
"Schon während der OP spürte ich, dass irgendwas nicht stimmte", erinnert sich Scheffer-Bulach. Danach verschwimmen ihre Erinnerungen. Blut, viel Blut. Hektik im OP-Saal. Stimmen aus dem "Off": "Wir zeigen ihr das Kind, vielleicht bringt das noch was." Vollnarkose. Was dann geschah, weiß die zweifache Mutter nur aus Erzählungen: starke Blutungen, Gebärmutter-Entfernung, Verlegung per Hubschrauber in die Uniklinik Ulm. Statt im kuscheligen Wochenbett lag sie eine Woche auf der Intensivstation und kämpfte ums Überleben. Es stellte sich heraus, dass sie eine Gerinnungsstörung hatte, die bis dato unbekannt war.
"Mein Mann blieb bei Lorena, sie wurde in die Kinderklinik verlegt", blickt die gelernte Bäckereiverkäuferin zurück. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinerlei Verdacht, dass mit dem Baby etwas nicht stimmt. Nach einer Woche wurde die junge Mutter verlegt, konnte endlich ihr Neugeborenes sehen: "Sie sah ganz normal aus, hat wenig geschrien." Und doch blieb bei Scheffer-Bulach ein seltsames Gefühl: "Ich schob das alles auf diese schreckliche Geburt."
Pränataldiagnostik
Genetische Veränderungen und Anomalien können während der Schwangerschaft gesehen werden. Weitere Risikofaktoren: Babys können im Mutterleib einen Schlaganfall oder bei der Geburt einen Sauerstoffmangel erleiden.
"Das verwächst sich schon", meint der Kinderarzt
Zuhause lief alles gut. Lorena sei ein entspanntes Baby gewesen, schlief schnell durch, forderte wenig. Sie brabbelte, begann zu sprechen, aber krabbelte lange Zeit nicht. Irgendwann fragte Scheffer-Bulach den Kinderarzt besorgt nach den motorischen Verzögerungen. "Er meinte, das verwachse sich schon noch", sagt die Fischbacherin. Ein typischer Spätzünder eben.
Laufen mit zwei Jahren – ein typischer Spätzünder?
Als Lorena mit zwei Jahren zu laufen begann, hatten sich ihre Eltern längst damit abgefunden, dass bei ihr alles eben ein bisschen länger dauert. An ein "Es" dachte jedenfalls noch niemand. Das änderte sich allmählich als die fröhliche, zufriedene Tochter mit drei Jahren in den Kindergarten kam. Die Eingewöhnung sei unkompliziert gewesen, doch dann berichteten die Erzieherinnen der Mutter immer wieder, dass Lorenas Verhalten sie vor Rätsel stellt. "Sie spielte viel für sich, war oft abwesend, konnte nicht malen, basteln funktionierte gar nicht.", sagt ihre Mutter. Heute weiß sie: Die Koordination vom Kopf bis zur Hand ist für Kinder wie Lorena ein großes Problem. Damals dachte sie, mit ein bisschen Förderung funktioniert das schon.
Dann die Trennung der Eltern
Für Lorena und ihre Mutter begann ein langer, leidvoller Weg. "Ich übte wie verbissen mit dem Kind Menschen zu malen, drängte sie oft zu Dingen, die sie gar nicht schaffte", blickt die 36-Jährige zurück. Lorena bekam Ergotherapie. Ihre Eltern trennten sich. Die zweifache Mutter zog mit den Kindern in ihren Heimatort Fischbach, wo der Großteil ihrer Familie lebt. Scheffer-Bulach, die 2015 erneut heiratete, ging nach Jahren als Hausfrau zurück in den Job.
Die Vorschulzeit wird zum Desaster
Lorena wechselte den Kindergarten, wurde Vorschulkind. Viel Veränderung für ein Kind, das ohnehin nicht einfach mitläuft. Die Vorschulzeit wurde zum Desaster – für wahrscheinlich alle Beteiligten. Lorena funktionierte nicht wie ein Kind, das in eine Regelschule eingeschult werden sollte.
Inklusion
In Baden-Württemberg kommt die Inklusion von behinderten Kindern im Schulalltag laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie nicht voran. Im Unterschied zum Bundestrend steigt die Exklusionsquote von 4,7 auf 4,9 Prozent. Die Meisten gehen also auf Förderschulen.
Die Erzieherinnen rieten der Mutter, sich mal bei der Tannenhagschule, einer Schule für Kinder mit Förderbedarf im Bereich geistiger Entwicklung, vorzustellen. Sabine Scheffer-Bulach reagierte schockiert: "Ich ging heulend aus diesem Gespräch: Was nahmen sich diese Personen raus, mir ins Gesicht zu sagen, dass meine Tochter behindert ist?" Sie bestand darauf, Lorena in die Fischbacher Grundschule einzuschulen. "Wenn dein Kind anders ist, hast du da aber verloren", sagt sie. Inklusion sei zu diesem Zeitpunkt noch ein Fremdwort gewesen, meint sie.
Nachts das Klingelhöschen und viele Tränen
Lorena litt, begann sich einzunässen. Ihre Mutter zog ihr ein Klingelhöschen an, das jede Nacht schrill auf das Missgeschick aufmerksam machte. Und verdrückte ihre eigenen Tränen, während sie das weinende Kind umzog. Irgendwann meldete sie Lorena auf der Merianschule an. An der Förderschule fühlte sie sich wohl – bis zur dritten Klasse.
IQ
Experten sprechen bei einem IQ von 70 bis 85 von einer Lernbehinderung, bei einem IQ von unter 70 von einer leichten Intelligenzminderung und ab einem IQ von unter 50 von einer mittleren bis schweren geistigen Behinderung.
"Ein neuer Kinderarzt brachte uns auf den Gedanken, uns mal in der Lukasklinik der Stiftung Liebenau vorzustellen", berichtet die 36-Jährige. Im Nachhinein gesehen sei das die Erlösung gewesen. Nach einigen Untersuchungen und Tests stand fest: Lorena ist Epileptikerin. Zu diesem Zeitpunkt tauchten bereits Zuckungen auf. Und die vielen eingangs erwähnten Fragen, die Scheffer-Bulach lange zu schaffen machten.
Antworten gibt es bis heute keine
"Wir könnten uns vorstellen, dass es bei Lorenas Geburt einen Sauerstoffmangel gab", sagt sie, "aber wir wissen es einfach nicht." Irgendwann hätte sie beschlossen, "Es" einfach anzunehmen und nicht mehr zu hinterfragen: "Mein Ex-Mann und ich wollten einfach das Beste daraus machen und dieses Kind annehmen wie es ist."
Sie rechnet bis 20 an den Fingern
Seither geht es bergauf. Lorena bekommt täglich Medikamente gegen die Epilsepie und das Bettnässen. Sie geht in die Hauptstufe der Tannenhagschule, rechnet bis 20 mit den Fingern und übt gerade den Schulweg dorthin. "Da sind alle Kinder wie sie. Und das war genau das, was ich lange für mein Kind gesucht habe. Nur wollte ich es nicht wahrhaben", sagt ihre Mutter heute. Das Leben mit dem "Es", es ist ein wenig leichter geworden. Sabine Scheffer-Bulach hat nach der Hochzeit mit Lorenas "zweitem Papa" den Job an den Nagel gehängt, um voll für ihre Tochter da zu sein.
Pflegestufen
Mit einer Pflegestufe besteht die Möglichkeit, Hilfe und Unterstützung in Form von Sach- und Geldleistungen zu bekommen – auch für Kinder. Anlaufstelle ist die Krankenkasse. Schwerbehinderten-Ausweise müssen separat beantragt werden.
Die 13-Jährige muss sich nachts oft übergeben, braucht Hilfe bei vielen alltäglichen Dingen, die andere Kinder in dem Alter längst alleine können. Seit Kurzem hat sie Pflegestufe III. "Sie wird noch viele Jahre ein Kind bleiben", sagt ihre Mutter. Ob sie je wirklich selbstständig wird, weiß niemand. "Ich hoffe so sehr, dass sie eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommt", sagt Sabine Scheffer-Bulach. Lorenas Traumjob? Im Krankenhaus arbeiten.
Die Serie
Wir.Frauen ist eine Reihe von Portraits über Frauen, die mitten im Leben stehen. In unserer redaktionellen Arbeit begegnen uns sehr häufig männliche Gesprächspartner. Männer besetzen den Großteil der Führungspositionen in Unternehmen, beim Staat, in unserer Stadt. Sie bilden die Mehrheit in den politischen Gremien. Und sie treten somit auch häufiger in die Öffentlichkeit. Wir zeigen Frauen, die sich vor allem im Hintergrund halten. Frauen, die tagtäglich Großartiges leisten – als Managerinnen, als Selbstständige, als Mütter, als Pflegerinnen – und nicht selten sind sie sogar alles auf einmal.
Wir zeigen alle Facetten des Frau-Seins – und zwar abseits der üblichen Rollen-Stereotype. Denn zur Identität eines Menschens gehört natürlich weit mehr als nur das Geschlecht. Und trotzdem gibt es, das haben die Debatten über Feminismus und #metoo sehr deutlich gezeigt, ein großes Bedürfnis in der Gesellschaft nach starken, weiblichen Stimmen. Wir lassen diese Frauen sprechen. Kennen Sie auch eine Frau aus Friedrichshafen oder Umgebung, die wir portraitieren sollten?
Schreiben Sie uns: friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de! (sab)