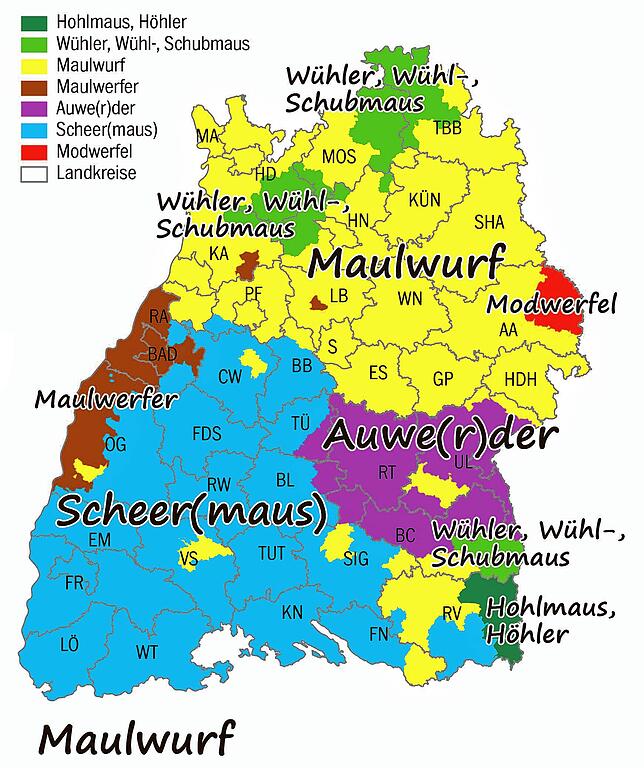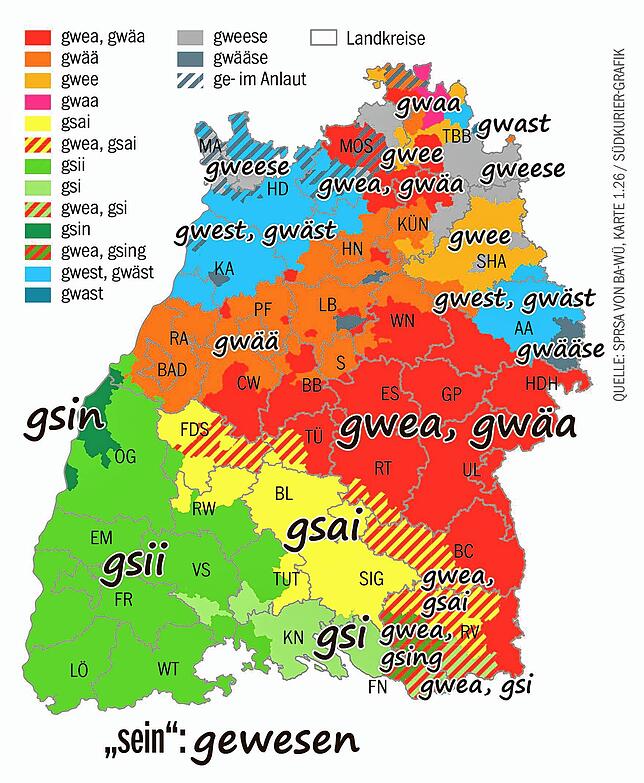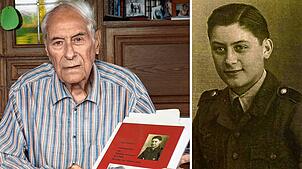„Dialekt isch Hoimat“: Drei Worte, gesprochen in breitem Schwäbisch, umreißen eigentlich alles. Zwei ältere Damen aus Bad Waldsee schlendern auf der Häfler Promenade entlang. Schwäbisch ist ihre Muttersprache, „des klingt oifach netter“, da sind sich beide einig. Die Freundinnen merken in ihrem Alltag selber, wie der Dialekt abnimmt. „Meine Enkelin versteht mich zwar immer, doch selber sprechen fällt ihr sehr schwer“, erklärt die Seniorin. „Das finde ich sehr schade.“
Das sieht die Landesregierung anscheinend ähnlich, denn Anfang April hat sie eine neue Dialektstrategie beschlossen, um Mundarten zu bewahren. Unter anderem soll in Kindergärten und Schulen die Pflege der Dialekte gefördert werden. Der SÜDKURIER hat sich in Friedrichshafen umgehört, wie Menschen über Dialekte denken.
Wenn es Möglichkeiten gibt, Mundarten zu fördern, sollten diese ergriffen werden, finden die beiden Damen an der Promenade. Schließlich bedeute Dialekt ja auch Integrität in der eigenen Region. Auf die Frage nach potenziellen Verständigungsschwierigkeiten antworten sie: „Wir können uns ja anstrengen, nicht so breit schwäbisch zu schwätzen, dann versteht man uns auch.“
Die Sprache muss für alle verständlich sein
Karim Ibrahim-Ouali sieht das anders. Die gebürtige Algerierin lebt erst seit sechs Jahren in Deutschland. „Für Leute wie mich ist es einfach leichter, Hochdeutsch zu lernen. Wenn jemand Dialekt spricht, fällt es mir sehr schwer, ihn zu verstehen“, erzählt sie und spricht sich gegen die bewusste Verwendung von Dialekten im Alltag und an Schulen aus. „Wenn zu Hause so gesprochen wird, ist das okay. Aber ansonsten sollten sich alle auf eine Sprache einigen.“
Auch Wilhelm Ipser sieht die Dialekte als Hindernis für die Integration von Zuwanderern. Der Schweizer fände es zwar schön, wenn man bestimmte Mundarten wieder aufleben lassen könnte, doch bei vielen verschiedenen kulturellen Hintergründen stelle sich das durchaus als schwierig heraus.
Austreibung von Dialekten
Seine Ehefrau Cornelia Ipser hat ihren alemannischen Dialekt seit ihrer Kindheit immer mehr verloren. „Schon sehr früh hat meine Mutter mir beigebracht, dass Hochdeutsch die gehobene Sprache ist und ich mir den Dialekt abgewöhnen soll“, erzählt sie. Man dachte, dass die Austreibung des Dialektes zum Erfolg der Kinder beiträgt. Dieses Phänomen trat oft in den 1960er und 70er Jahren auf. Doch Cornelia Ipser ist vom Gegenteil überzeugt. Das frühe Erlernen von unterschiedlichen Sprachen und Dialekten fordere das Gehirn noch einmal anderweitig positiv heraus und sei für junge Menschen nur von Vorteil.
Die Meinung der Jugend
Auch Tabea Ott aus der Nähe von Stuttgart wurde der Dialekt ein Stück weit ausgetrieben. „Ich bin mit Schwäbisch aufgewachsen, doch im Grundschulalter wurde mir der Dialekt abgewöhnt, um Probleme bei der Rechtschreibung zu verhindern.“ Die Schülerin findet die Beherrschung des Wechsels vom Dialekt ins Hochdeutsche wichtig. Es sei jedoch schade, dass Dialekte in der Schule so negativ aufgenommen würden. Ihre Freundin Jonna Gierl hat kaum Bezug zu Dialekten. „Aber ich finde es schön, wenn man es kann und die Weitergabe ist sehr wichtig.“

Dass Jugendliche im Dialekt sprechen, ist heutzutage kein Regelfall mehr. Für den siebzehnjährigen Vincent Kastek bedeutet Schwäbisch Heimat, Tradition und Zugehörigkeit. Seine ganze Familie spricht im Dialekt und auch in seinem Freundeskreis ist die Mundart durchaus verbreitet. Anders war es in der Schule. „Es kam schon vor, dass Mitschüler meine Sprache ins Lächerliche gezogen habe und ich als der Landwirt abgestempelt wurde, doch daran war ich gewöhnt“, schildert der Klufterner.

Die meisten Lehrer haben den Dialekt erfreulicherweise unterstützt und gefördert. Vincent fände es sehr enttäuschend, wenn sein Dialekt einmal ganz verloren ginge. „Es muss einen Weg geben, das Ganze wieder zurückzubringen“, meint er.