Auf dem Schränkchen in einem Zimmer im Matthias-Claudius-Haus in Waldshut stehen Bilder von Familienmitgliedern und von einem weißen Hund. Es sind Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten. Aus dem Radio ist leise Musik zu hören. Das Zimmer sieht gemütlich aus. Die Uhr an der Wand ist stehengeblieben.
Die 37-jährige Steffi Kootz wäscht die ältere Dame, die in diesem Zimmer wohnt. Sie geht freundlich auf die Frau ein, die kein einziges Wort spricht. Und man merkt der Pflegenden sofort an, dass sie ihren Beruf gerne ausübt, dass sie darin aufgeht. Sie mag den Umgang mit den Menschen, das Individuelle: „So schwer wie es in manchen Situationen auch ist, so schön ist es auch. Es kommt so viel zurück.“ Und schon gleich ist klar, was sie meint: Die alte Dame lächelt.
Der Verdienst
Auf dem Markt fehlen die Fachkräfte, das weiß Steffi Kootz. Das schlechte Image zusammengesetzt aus Missständen bei den Arbeitsbedingungen, schlechter Bezahlung und schwierigen Arbeitszeiten würden dazu führen, dass sich immer weniger Menschen bewerben. Allerdings: „Die Problematik mit dem Fachkräftemangel in der Pflege gibt es – aber bei uns im Haus nicht“, sagt Kootz.
Und warum nicht? „Ich habe woanders als Fachkraft weniger verdient, als hier eine Hilfskraft verdient“, erklärt die 37-Jährige, die heute als Pflegedienstleitung eingestellt ist. Kirchliche Träger, wie hier der Evangelische Diakonieverein Waldshut-Tiengen, würden nach Tarif und damit sehr gut bezahlen. „Die kleinen privaten Häuser können da nicht mithalten“, sagt Kootz. Bei diesen sei dann hier am Hochrhein auch der Abgang der Mitarbeiter in die Schweiz wesentlich höher.
Sie selbst wohnt in Lenzkirch, 40 Kilometer vom Arbeitsplatz in Waldshut entfernt. Nach ihrer Elternzeit stellte sich für sie die Frage, ob sie künftig näher am Wohnort arbeiten wolle. Doch dort hätte sie eben auch nur in einem „kleinen Haus“ tätig sein können. Finanziell lohne sich für sie der lange Arbeitsweg, auch ohne Vollzeitstelle. Ihre Kollegin Silvia Maier ist, wie sie selbst sagt, ebenfalls glücklich in ihrem Beruf und zufrieden mit der Bezahlung.
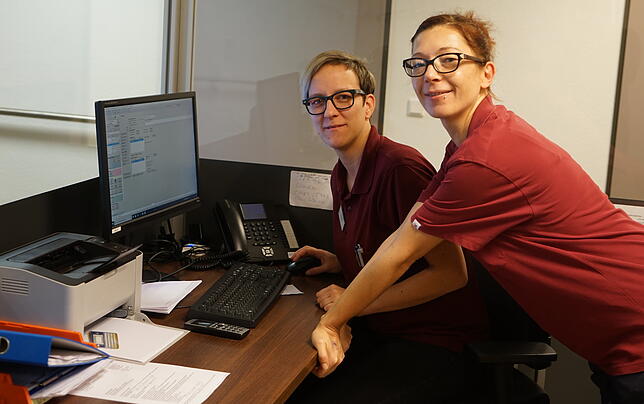
Die Arbeitszeit
Für Steffi Kootz als Mutter sei die flexible Arbeitszeitgestaltung im Haus wunderbar. Sie könne morgens später anfangen, sobald sie das Kind zur Kita gebracht hat. Es gebe weitere Arbeitszeitmodelle, auf jeden Mitarbeiter abgestimmt. „Genau so etwas muss man machen, wenn man in der Pflege Personal sucht – und wenn man es behalten will“, sagt Kootz.
Die Zeit
Kootz zieht die Dame wieder an, hilft ihr beim Hinsetzen. Und dann wird es etwas komplizierter: Die Bewohnerin des Altenheims kann nicht mehr selbst aufstehen. So unterstützt eine Aufstehhilfe. Daran schnallt Kootz die Dame an und mit ihr wird sie automatisch vom Sitzen ins Stehen gebracht und von dort in den Rollstuhl.
Kootz wäscht die Frau am Waschbecken weiter. Doch das Gesicht wäscht sie sich alleine. Die Pflegedienstleiterin will der Seniorin das Gefühl geben, dass sie auch noch etwas alleine kann, ihre Selbstständigkeit unterstützen.
Kootz nimmt sich sehr viel Zeit. „Ich glaube schon, dass man genug Zeit für jeden einzelnen Bewohner hat, wenn man sich richtig organisiert“, sagt sie. Morgens betreue eine Fachkraft acht bis zehn Bewohner. Das sei schon viel. Pflegefachkraft Silvia Maier sagt zum Zeitmanagement: „Morgens ist es schon eng getaktet, aber im Spätdienst ist es entspannter.“
Die Bürokratie
Als Pflegedienstleitung weiß Steffi Kootz, dass der Berg an Papierkram immer mehr wird: „Nicht der Personalmangel, sondern die Bürokratie, nimmt uns die Zeit“. So müsse sie alles dokumentieren und begründen, was auf der Station gemacht wird. „Ist etwas nicht dokumentiert, ist es offiziell auch nicht gemacht“, erklärt sie.
Schließlich gebe es auch Ärger wenn etwa eine verordnete Blutabnahme nicht gemacht wurde, weil der Bewohner es schlichtweg an diesem Tag nicht wollte. Dabei sei es für Kootz viel wichtiger, auf den Willen des Menschen einzugehen als auf strikte Verordnungen. Denn die Blutabnahme könne in der Regel auch am darauffolgenden Tag durchgeführt werden.

Die Emotionen
Steffi Kootz hat zuerst eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht, daraufhin folgte die Ausbildung zur Altenpflegerin. Seit 2003 arbeitet sie nun in der Pflege. In diesem Beruf sei es einfach schöner, dass sie die Menschen über eine längere Zeit begleiten könne. Alles sei sehr intim.
Doch wie ist es da mit den Gefühlen? Lässt man manches zu nah an sich ran? „Ohne Emotionen geht es nicht, aber man braucht auch die nötige Distanz“, sagt Kootz. Es gebe viele Pflegekräfte, die das Passierte mit nach Hause nehmen würden. Es sei auch die Aufgabe einer Pflegekraft mit den Menschen den letzten Weg zu gehen, sie beim Sterben und die Angehörigen bei der Trauer zu begleiten. Das müsse man können. „Man darf es eben nicht nur als Job sehen, sonst funktioniert es nicht“, sagt Kootz.
Doch auch in der Pflege gebe es unterschiedliche Auffassungen: „Ganz im Gegensatz zu den Vorurteilen mit dem mangelnden Verdienst in diesem Beruf, unterstelle ich vielen Pflegekräften, dass sie ihren Beruf nur wegen des Geldes machen. Und denen ist dann einiges gleichgültig“, sagt Kootz.
Die fertig angekleidete Seniorin wird zum Frühstück gefahren. Kootz füttert sie und erinnert sie dabei immer wieder ans Kauen und Schlucken. Eine weitere Pflegefachkraft im Frühstücksraum macht mit einigen Bewohnern Rhythmusspiele. Bei der Gymnastik hat eine der teilnehmenden Frauen richtig viel Spaß, lacht viel und scherzt. Wieder ein solcher Moment, in dem viel für die Pfleger zurückkommt und sie die Freude am Beruf erfahren.






