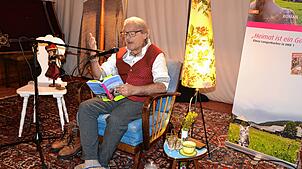In der Sommerzeit taucht der einstige Meierhof besonders nachdrücklich aus den Schichten der Erinnerung auf. Seit genau 30 Jahren gibt es das Gebäude nicht mehr, das den Platz des heutigen Zentralen Omnibusbahnhofs füllte. Die in das Gedächtnis der ihn Überlebenden eingegangene Form dieses landwirtschaftlichen Anwesens stammte aus dem Jahr 1907, fußte aber auf jahrhundertealten Vorgängerbauten des Benediktinerklosters.
Mit dem Kauf 1933 der ehemaligen, als Spinnerei zweckentfremdeten Klosteranlage erwarb die Gesellschaft Jesu, also der Jesuitenorden, auch den zum Gesamtpaket gehörenden Meierhof aus der Konkursmasse der Spinnerei. Für die wenigen Jahre bis zum Verbot des Schulinternats im Frühjahr 1939 und dann noch einmal für vier Nachkriegsjahrzehnte wurde die früher klösterliche Ökonomie zur Nahrungsmittelzentrale für die Kollegsküche.
Zahlen können schnell ermüdend sein, aber sie verdeutlichen in diesem Falle das Ausmaß des Erwerbs und der Arbeitslast. Die landwirtschaftliche Nutzfläche umfasste 26 Hektar Weiden, 52 Hektar Wiesen und sechs Hektar offenes Ackerland. Fünf Hektar Streuwiesen, neun Hektar Hofreite, Ödland und Wege, zwei Hektar Garten und 30 Hektar Wald ergänzten die zum Kurzbegriff Meierhof zählenden Arbeitsflächen und Besitzungen.
Der Meierhof selber, also das Wirtschaftsgebäude als sogenannter Eindachhof, teilte sich auf in die große Futterküche, den Zuchtschweine- und Mastschweinestall, den Viehstall für 40 Vorderwälderkühe und einen Farren und schließlich die Scheune mit Hocheinfahrt. Es gab auch einen Hühnerstall mit Wechselauslauf für rund 300 Hühner (weiße Leghorn und rebhuhnfarbige Italiener).
Eine letzte Renovierung
Acht bis zwölf feste Arbeitskräfte, zusätzliche Aushilfen und ein riesiger Maschinenpark hatten die Mammutaufgabe zu bewältigen. Die blühenden, wenn auch arbeitsschweren Zeiten veranlassten 1957/58 eine letzte Renovierung, die allerdings zu den Ansprüchen des ebenfalls sprießenden Kurorts keinen unüberwindlichen Widerspruch darstellen sollte. So gab es keine Unterdachtrocknungsanlage, da sie wegen der Trockenluft in der Mittagszeit – während der damals noch streng beachteten und sogar bestraften Kurruhe – hätte laufen müssen.
Borstenvieh als Zeittakter
Von Mitte Mai bis Anfang Oktober durfte auch kein wirtschaftseigener Dünger auf die genutzten Flächen ausgebracht werden – die Gerüche hätten die viel gepriesene Erholungsluft doch arg verfremdet. Es genügten die dem Haus, den Schweinen (die Kühe waren ja auf der Hochalm Ziegelfeld) und den Ablagerungen entströmenden Düfte, die in den kurörtlichen Kern herüberwehten. Und zudem war das Borstenvieh der beste Zeittakter: Man hätte fast die Uhr stellen können nach der Genauigkeit des spätnachmittäglichen, irgendwie ohrenbetäubenden Geschreis vor der Fütterung.
Das Ende
Der ausbleibende Nachwuchs bei den Jesuitenbrüdern – es sei gerne erinnert an die unvorstellbar arbeitsamen und fachlich versierten Brüder Bachmair, Binder, Dudler und Michl – und die betriebswirtschaftliche Scharfrechnung verwiesen die Landwirtschaft 1988 und das Gebäude 1989 ins Geschichtsbuch. Der Meierhof war für die meisten St. Blasier kein romantisches Herzensanliegen, aber zumindest eine gewachsene Verbindung und eine verstandesorientierte Verbundenheit, die nach 40, 50 Jahren ein erinnerungsreiches Lächeln hervorzaubert. Heute füllt den Platz ein Omnibusbahnhof.