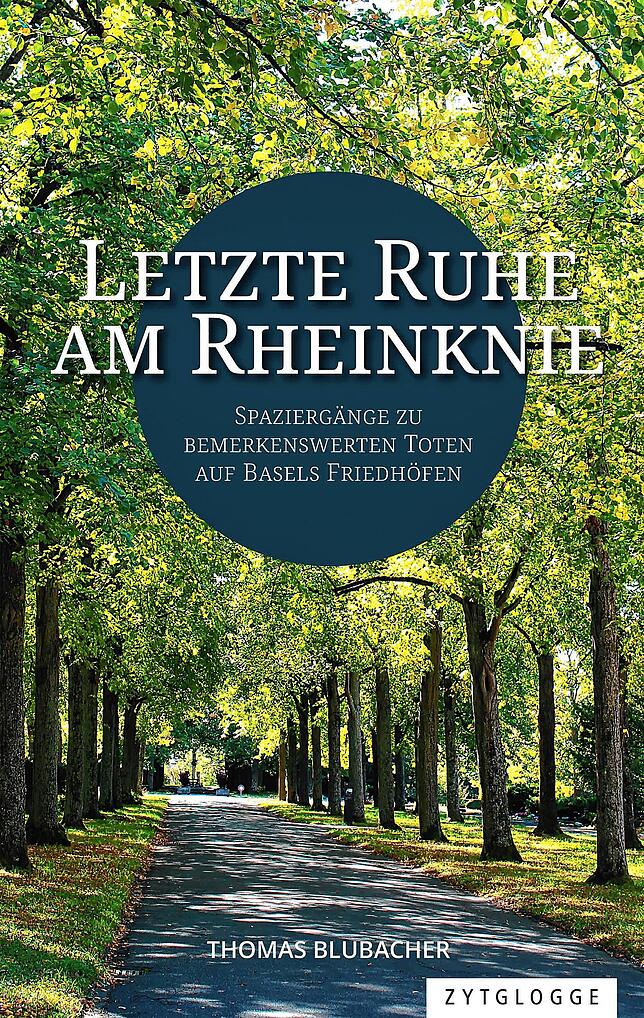Keine Frage, der Friedhof am Hörnli in Riehen, der größte der Schweiz, gehört nicht wirklich zu den berühmten Ruhestätten. Da gibt es weit bekanntere Prominentenfriedhöfe mit extravaganteren Grabbauten, etwa den Wiener Zentralfriedhof, wo Beethoven begraben liegt, oder den Friedhof Père Lachaise in Paris, wo Berühmtheiten wie die Schriftsteller Molière, Honoré de Balzac, Marcel Proust, Oscar Wilde und der Komponist Frédéric Chopin ihre ewige Ruhe gefunden haben. Damit kann Basels Zentralfriedhof nicht mithalten. Hier sind keine Weltstars begraben wie Edith Piaf und Jim Morrison, zu deren Grabstätten heute noch Millionen nach Paris pilgern. Aber es gibt doch einige prominente Namen auf diesem Gottesacker am Fuß des Grenzacher Horns, ganz grenznah, auf dem Territorium des Kantons Basel-Stadt gelegen.
Unzählige Persönlichkeiten
Hier sind unzählige Persönlichkeiten bestattet, die Lokal- und Schweizer Landesgeschichte, aber auch ein Stück Weltgeschichte geschrieben haben. Darunter die beiden berühmten Karls, Barth und Jaspers, aber auch der bekannteste Schweizer Modeschöpfer und der Erfinder der lila Kuh.
Über die fünf heute noch genutzten Basler Friedhöfe hat der Rheinfelder Autor Thomas Blubacher ein Brevier herausgebracht, das in Form von Spaziergängen zu bemerkenswerten Toten führt. Für sein kürzlich erschienenes Buch „Letzte Ruhe am Rheinknie“ ist der Autor alle Grabreihen abgegangen und hat sich auf die Spuren der Menschen begeben, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Die außergewöhnlichen Biografien und Geschichten hinter den Schicksalen haben ihn interessiert.
Trotz seiner 54 Hektar Fläche – mehr als 70 Fußballfelder groß – und zehntausenden Gräbern ist der Friedhof am Hörnli ein Ort der Stille und Besinnung, ein weitläufiges parkähnliches Areal mit mediterraner Atmosphäre, Wegen und Alleen, sonnigen Reihen, waldigen Ecken und schattigen Bäumen, vielen klassischen Gräbern und alten, verwitterten und überwachsenen Grabmalen, auf deren Tafeln man die Inschriften kaum noch entziffern kann. Es ist übrigens auch der Friedhof mit den meisten Rehen, die sich gern äsend am Grabschmuck laben.
Der Besucher fühlt sich irdisch klein, wenn er die symmetrische Gartenanlage mit den Terrassen betritt und die monumentale große Freitreppe hinaufsteigt, wo die beiden Hauptgebäude links und rechts mit ihren Säulen ehrfurchtgebietend wirken. In einem ist die Sammlung des Schweizer Museums für Bestattungskultur untergebracht, eines der wenigen Bestattungsmuseen Europas. Gerade in dieser herbstlichen Stimmung, wo der November mit seinen Totengedenktagen wie Allerheiligen naht, kommen dem Besucher dieses imposanten Friedhofs beim Betreten Gedanken über die Vergänglichkeit. Ist es doch die Zeit, in der sich Menschen verstärkt mit dem Tod auseinandersetzen und mit der Friedhofskultur beschäftigen.
Friedhöfe, sagt Blubacher, sind aber nicht nur Orte der Trauer, die man zu leidvollen Anlässen besucht, sondern auch eine Quelle der Kulturgeschichte. Wer Interesse an Basler Geschichte hat, wird in dieser Publikation fündig. Der Autor lädt die Leser dazu ein, ihm auf Rundgängen zu ausgesuchten Gräbern zu folgen. Einige Namen aus den Bereichen Theater, Literatur, Musik, Kunst, Wirtschaft, Industrie, Gesellschaft und Sport sind geläufig, bei anderen bedarf es einer „kleinen Anschubhilfe“. Blubacher folgt auf seinen beschriebenen Routen zu den Ruhenden keinem Popularitätsranking, sondern berichtet über das Bestattungswesen und die Beerdigungskultur, macht aber auch einen Exkurs über Gräberfelder vor unserer Zeitrechnung, führt zu Begräbnisplätzen des Mittelalters und ins Basler Münster zu Grabmalen und Epitaphen und den Gebeinen des 1563 in Basel gestorbenen Humanisten Erasmus von Rotterdam.
Nicht nur den Zentralfriedhof am Hörnli beschreibt Blubacher, sondern historische Bestattungsorte und die noch verbliebenen Friedhöfe wie den israelitischen Friedhof und den Wolfgottesacker. Dieser älteste Friedhof gilt als der schönste aller Basler Gottesäcker, idyllisch gelegen mitten im Gewerbegebiet Dreispitz, ein Refugium der Einkehr inmitten der pulsierenden, lebendigen Stadt, umgeben von Tramlinien, Gleisen, Straßen und naher Industrie. Seinen Namen hat das Wolffeld von dem Gelände, in dem im 17. Jahrhundert noch tatsächlich Wölfe vor der Stadtmauer umher streiften. Heute beschützen hier unzählige Engel aus Marmor oder Eisen die Verstorbenen. In dieser 1872 eröffneten altehrwürdigen Stätte mit altem Baumbestand, wertvollen Grabsteinen und klassizistischen Familiengrabstätten scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.
Bekannte Basler Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts sind auf dem Wolf bestattet. In den verschiedensten Sektoren verdienen einige Gräber Aufmerksamkeit. Der kunstsinnige Raoul La Roche, ein Bankier, dem das Basler Kunstmuseum Schenkungen von Kunstwerken verdankt, liegt hier ebenso begraben wie bekannte Musiker, etwa die Harfenistin Ursula Holliger, der Jazzpianist und Bandleader George Gruntz oder der Komponist Klaus Huber (auf dessen Grab ein schlichtes Holzkreuz hinweist). Wie der Autor feststellt, kann der Wolfgottesacker mit einer „weit höheren Dichte an Prominentengräbern“ aufwarten wie der Hörnlifriedhof, der 14 Mal so viele Gräber hat. Und doch suchen bis heute Studierende aus Korea, den USA und Deutschland hier das Grab von Karl Barth auf, einem der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, der in der NS-Zeit eine moralische Instanz war. Dass der Dogmatiker Barth aber kein Heiliger war, sieht man daran, dass auf dem schlichten Grabstein auch der Name Charlotte von Kirschbaum steht, die zusammen mit der Ehefrau im Haushalt Barth lebte und nicht nur Barths Assistentin war, wie alle wussten.
Der berühmteste Name auf diesem Friedhof ist der des Philosophen Karl Jaspers, der sich in kritischen Schriften zu politischen Fragen wie Atombombe und Wiedervereinigung äußerte und 1969 im Alter von 86 Jahren in Basel starb. Auch dessen persönlicher Assistent, der Schweizer Philosoph Hans Saner, ist hier beerdigt. Die sterblichen Überreste des Kunsthistorikers Jacob Burckhardt, dessen Konterfei eine 1000-Franken-Note zierte, wurden vom Wolfgottesacker auf einen „Ehrenhof“ aufs Hörnli umgebettet.

Neben mehreren Nobelpreisträgern finden sich auf diesem Gelände auch die Gräber des Galeristen Ernst Beyeler, dem Initiator der Kunstmesse „Art Basel“ und des schweizweit meistbesuchten Museums Fondation Beyeler, sowie zahlreicher anderer Personen des Basler Kulturlebens wie der Komponist Hermann Suter, der Begründer des ersten Großvariéte-Theaters, Karl Küchlin, bei dem sogar Joséphine Baker auftrat, oder die TV-Legende Paul Spahn, dem am Ende seiner Karriere als Tagesschausprecher der Fauxpas passierte, dass er während einer laufenden Sendung einschlief.
Zu den „bemerkenswerten Toten“ gehören auch Theater-Publikumsliebling Jörg Schröder, der Sterne-Koch Hans Stucki sowie Sportgrößen wie der Schweizer Fußball-Nationalspieler und erfolgreiche Torjäger Seppe Hügi, genannt „Goldfiessli“, auf dessen Grab passend ein steinerner Fußball als Memento mori thront.

Auch wenn sie nicht in Blubachers Friedhofsführer erwähnt werden, kann man doch die Grabstätten der Brüder Fritz und Hans Schlumpf, deren erlesene Oldtimer-Sammlung als französisches Nationalmuseum im elsässischen Mulhouse weiterlebt, ebenfalls auf dem Hörnlifriedhof entdecken.