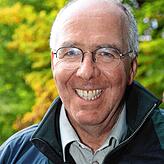Als wär‘s bestellt, liegt der Stamm quer über dem leicht zum Taborberg ansteigenden Weg. Die Gruppe der Stadträte, die sich bei einer Waldbegehung ein Bild vom Zustand im Konstanzer Forst machen, wechselt in den Gänsemarsch, nach und nach nimmt man die Hürde. Wenig später legt Revierleiterin Irmgard Weishaupt einen Zwischenstopp ein. Mit Verweis auf das noch in Sichtweite liegende Bruchholz sagt sie, dass der Weg am vorangegangenen Tag noch frei passierbar war. Und sie erklärt, warum man beim Wandern und Spazieren durch den Wald höllisch aufpassen muss. Ständig fallen Bäume um oder Äste brechen.
Wald als Gefahrenzone
Es ist ein Problem, das es früher so nicht gab. Irmgard Weishaupt und Walter Jäger vom Forstamt des Landkreises führen die Fallsucht im Wald auf die Dürre im vergangenen Jahr zurück, und die wiederum schreiben sie dem Klimawandel zu. Damit erhöht sich die statistische Gefahr für Leib und Leben, denn die Menschen zieht es infolge der Pandemie in deutlich größerer Zahl ins Grüne. Als hätten die Leute vom Forst mit dem Holzen im Wald also nicht schon genügend zu tun, müssen sie jetzt aber auch noch kommunikativ aufräumen. Irmgard Weishaupt berichtet beispielsweise über Beschwerden, als ein Waldweg aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde.

Es ist nur ein Beispiel für den steigenden Gesprächsbedarf. Einiges zu erklären gibt es etwa bei angeblichen Plantage-Pflanzungen am Taborberg. Sie sind darauf zurückzuführen, dass nach Einschätzung der beiden Experten die Buche ohne den Eingriff des Menschen am Taborberg so gut wie alle anderen Baumarten verdrängen würde. Das aber ist nicht erwünscht, denn der Wald besitze neben seiner ökonomischen Nutzfunktion und seiner ökologischen Bedeutung zugleich den Wert eines Erholungsgebiets erster Güte. Also soll auch die Eiche ihren Platz in der Waldfamilie erhalten – sie allerdings benötigt Freiflächen und damit sie überhaupt eine Chance gegen die Buche hat, wird sie in Reihen gesetzt. Das erleichtert die Pflege und im Laufe der Zeit lichten sich die Reihen auf natürliche Weise.
Von Plantagen-Nutzung kann mithin keine Rede sein, im Gegenteil werden die in Reih und Glied gepflanzten Eichensetzlinge langfristig der Monokultur aus Buchen vorbeugen. „Wie freuen uns am wachsenden Interesse für den Wald“, sagt Irmgard Weishaupt, „aber wir müssen den Leuten eben vieles erklären.“ Dazu gehört die Beantwortung von Klagen über Erosionen auf Wegen, die durch Starkregenfälle verursacht werden. Wie das durch die Instabilität der Bäume verursachte Mikado im Wald sind sie auf den Klimawandel zurückzuführen.
Hier spitzen die Stadträte aus naheliegenden Gründen die Ohren. Es handelt sich um ein brisantes Thema, dessen Dimension nach Angaben von Irmgard Weishaupt noch immer nicht erkannt ist. So sei die Debatte um eine Begrenzung des durchschnittlichen Temperaturanstiegs um 1,5 Grad unter Fachleuten schon längst ad acta gelegt. Dann folgt der Hammer: Irgendwo zwischen Brombeerfeld, Eschensterben und himmelwärts dürr ihre Äste richtende Buchen erklärt die Revierleiterin, dass für Konstanz die derzeit ohnehin schon erhöhte durchschnittliche Temperatur von 9,4 Grad im Lauf der nächsten hundert Jahre auf 13,4 Grad ansteigen wird. Es wird also warm, sehr warm sogar.
Doch niemand ergreift das Wort. Auch bei der Besichtigung eines illegal mitten im Wald gebauten Bike-Trails wirkt das Schweigen wie eine Beschwörung. Irmgard Weishaupt und Walter Jäger nutzen hier einen ausgebuddelten Graben (auch dies ein Indiz für die verstärkte Nutzung des Waldes zur Freizeitgestaltung) als Anschauungsbeispiel für die Folgen der Dürre des Jahres 2020. Trotz des verregneten Sommers in diesem Jahr ist deutlich zu erkennen, dass das Wasser die unteren Waldbodenschichten nicht erreicht. Laut Walter Jäger hat der Regen zwar dafür gesorgt, dass der Gesamtboden wieder eine gute Grundfeuchte erreicht, aber sie genügt nicht für die tieferen Schichten und die frühere Grundwasser-Verbindung. Das liegt laut Irmgard Weishaupt auch daran, dass die Bäume nach der extremen Trockenheit den Regen wie ein Schwamm aufgesaugt haben.
Paradoxerweise allerdings sorgt ausgerechnet der Regen für ein verstärktes Sterben insbesondere der Eichen. Revierleiterin Irmgard Weishaupt spricht von Regenholz, das den Boden rund um die Bäume so aufgeweicht hat, dass die Wurzel den Halt verlieren. Auch dies eine Gefahr für jeden Waldgänger, und nicht zuletzt für die Waldarbeiter. Anderen Hölzer wie der Esche setzt ein spezieller Pilzbefall zu, so dass dieser Art am Taborberg so gut wie keine Überlebenschance eingeräumt wird. Auf der anderen Seite wurde dies auch schon von der Ulme behauptet, doch ihre Art treibt‘s immer wieder aus dem Boden. Walter Jäger räumt ihr deshalb eine „winzige Chance“ fürs Überleben ein.
Was letztlich in einem direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel steht, lässt sich aus der Waldbegehung und den Erläuterungen der beiden Forstleute nicht erschließen – der durch die Erderwärmung bewirkte Veränderungsprozess wird gleichwohl klar. Mit einem Anflug von Ironie sprechen Irmgard Weishaupt und Walter Jäger von einem „dynamischen Geschäft“. Sie verbinden dies mit einer klaren Botschaft für alle Waldgänger vom Spaziergänger über den Jogger bis hin zum Biker. Der Wald verliert zunehmend sein romantisches Wesen und wird zunehmend zur Gefahrenzone.