Wer darf auf dem Eckgrundstück gegenüber der Gärtnerei Spiegel am Rand von Allmannsdorf, links der Straße in Richtung Staad, bauen? Und wer kann es sich leisten, das Grundstück von der Stadt zu kaufen, ohne darüber auf unbestimmte Zeit verfügen zu können?
An einer rund 644 Quadratmeter großen Fläche im Zwickel zwischen Mainaustraße und Egger Straße entzündet sich eine Debatte, wie in Konstanz überhaupt noch günstig Wohnraum geschaffen werden kann. Und ob die Stadt Grundstücke überhaupt noch verkaufen soll oder ob es nicht besser wäre, sie in Erbpacht zu vergeben, um die Erst-Investition für Bauwillige einigermaßen in Grenzen zu halten.
Das Beispiel am Stadtrand zeigt das Dilemma gut auf. Das Grundstück – noch vor wenigen Jahrzehnten hätte man auf etwas über 600 Quadratmetern wohl eher ein Einfamilienhaus gesehen – ist laut Stadt fast 900.000 Euro wert. So viel plus Nebenkosten müssen Bauwillige schon einmal bezahlen, ohne dass auch nur ein Kubikmeter Erde ausgehoben oder eine Kellerwand betoniert ist. Und billiger kann die Stadt es auch nicht abgeben: „Unter Wert verkaufen dürfen wir es nicht“, heißt es dazu aus dem Amt für Liegenschaften und Geoinformation.
Kann – und soll – die Stadt Spekulation verhindern?
Aber verkaufen soll es die Stadt ja auch gar nicht, sagen vor allem FGL&Grüne im Gemeinderat. Die Stadt solle, in Erweiterung einer Regelung für ufernahe Flächen im kommunalen Eigentum, Grundstücke nur noch in Erbpacht abgeben. Denn so werde verhindert, dass mit der knappsten Ressource in der Stadt, Fläche, spekuliert werde. Und für Bauwillige sinken die Kosten erst einmal, weil sie das Grundstück ja nicht auch noch bezahlen müssen, sondern dafür lediglich eine monatliche Pacht entrichten müssen. Die allerdings kann erheblich sein, wie sich zuletzt in der Debatte um die Erbbauzinsen der Spitalstiftung zeigte.
Oberbürgermeister Uli Burchardt sieht es ohnehin anders. „Man kann die Erbpacht nicht ernsthaft als besonders sozial verkaufen“, sagt er. Zudem habe die Stadt kurz- oder mittelfristig baureife Grundstücke im Wert von 210 Millionen Euro im Bestand, da sei es mehr als sinnvoll, auch einmal etwas zu verkaufen, sonst „hätten wir eine ganz andere Mathematik“. Wie im konkreten Fall an der Mainaustraße. Dort sollen ausdrücklich Baugruppen mit mindestens drei Partnern zum Zug kommen, die sich die Kosten teilen können, um Wohneigentum zu schaffen.
Hinzu kommt: Nicht nur lehnt die Wobak das Bauen auf Erbpacht-Grundstücken grundsätzlich – und wohl aus gutem Grund – ab. Auch Bauherren haben es schwer, für ihr Vorhaben einen Kredit zu bekommen, wenn sie das Grundstück nicht als Sicherheit vorweisen können. Darauf verweisen die Stadträte Joachim Filleböck (CDU) und Jan Welsch (SPD). Filleböck wird sogar noch deutlicher: „Dass Erbbau günstiger ist, ist ein Märchen“, sagt er ans politische Gegenüber im Ratssaal gerichtet.

Achim Schächtle (FDP) rechnet in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Klimaausschusses (HFK) vor: Für ein Grundstück im Wert von 880.000 Euro läge die Pacht bei 3000 Euro. Pro Monat. Und fügt zum Thema Spekulation süffisant an, die sei „durch die Stadt soweit möglich schon vorweggenommen“ durch den stattlichen Preis.

Für das Baugrundstück in Allmannsdorf hat sich die Stadtverwaltung nun eine besondere Lösung einfallen lassen: Es wird zwar verkauft, aber unter strengen Vorgaben. So gibt es nicht nur ein Punktesystem, nach dem die Vergabe an eine Baugruppe geregelt wird.
Die Stadt legt unter anderem auch vertraglich fest, dass sie das Grundstück nach 85 Jahren zurückkaufen kann. Zum ursprünglichen Preis plus Inflationsausgleich. Das macht einen teuren Weiterverkauf während der Laufzeit unattraktiv, weil jeder Erwerber wüsste, dass er damit am Ende draufzahlen würde. Für das draufstehende Haus würden dessen Eigentümer dann eine Entschädigung erhalten – wenn die Stadt ihre Option nutzt, wozu sie allerdings nicht verpflichtet ist, da der Vertrag auch verlängert werden könnte.
Nach 85 Jahren kann die Stadt zurückkaufen
Für den CDU-Stadtrat Filleböck ist das eine kluge Kombination aus klassischem Verkauf und Erbpacht: Die Bauwilligen können das Grundstück als Sicherheit einsetzen, die Stadt behält aber im Kern ihren Daumen auf der Fläche. FDP-Mann Schächtle ist weniger überzeugt: „Für die Enkel wird es eng“, warnt er, und gegen Ende der Laufzeit gebe es kaum noch Anreize, in das Gebäude zu investieren. SPD-Stadtrat Jan Welsch dagegen meint: „Das heißt nicht, dass dann hier der Sozialismus ausbricht“. Die soeben auch vom Gemeinderat beschlossene Regelung sorge dafür, „dass niemand auf die Idee kommt, die Immobilie zu absurden Preisen zu verkaufen“.
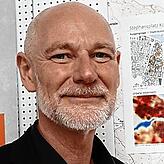
Ab wann sich Baugruppen um das Grundstück bewerben können, steht noch nicht fest. Wer den Zuschlag erhält, muss den Bau innerhalb von drei Jahren abgeschlossen haben und die Immobilie mindestens 15 Jahre lang selbst nutzen. Der Zuschlag soll in der ersten Jahreshälfte 2026 erfolgen, der Kaufvertrag wird aber erst nach Vorliegen der Baugenehmigung erfolgen.








