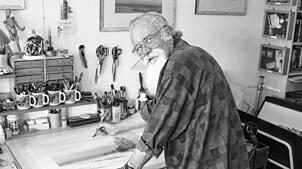Solche Bilder will niemand sehen: Jugendliche, die irgendwann im Laufe des Schmotzigen Dunschtigs irgendwo in der Stadt regungslos in ihrem Erbrochenen liegen, von Sanitätern und Notärzten versorgt sowie in die Kinderklinik eingeliefert und dort medizinisch behandelt werden müssen.
„Jeder, der nicht im Krankenhaus landet, ist ein Erfolg“
Für Irene Jun vom Jugendamt ist die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren die Zahlen der Komasäufer gefühlt zurück ging, eher beiläufig. „Das ist eine Messgröße, die mich nicht interessiert“, sagt sie. „Das Thema ist für uns immer wichtig. Jeder Jugendliche, der nicht in diese Situation kommt, ist ein Erfolg.“
Zweier-Teams mit Brezeln und Wasser
Seit 2016 gehen Mitarbeiter von Jugendamt, Jugendzentrum und Eltern am Schmotzige Dunschtig in Zweier-Teams von 9 bis 15 Uhr mit Brezeln und Wasser durch das Stadtzentrum – auch als Reaktion auf die zunehmenden Alkohol-Exzesse an diesem Tag. „Wir sind Ansprechpartner und suchen auch gerne selbst das Gespräch mit Kindern und Jugendlichen“, sagt Irene Jun.
Zehn Teams werden unterwegs sein, zu erkennen sind sie an den gelben Westen – und den Rucksäcken mit dem Proviant. „Wir haben beobachtet, dass die Jugendlichen vermehrt auf sich selbst aufpassen“, weiß Irene Jun zu berichten. Die ehrenamtlichen Helfer bieten das Gebäck und das Wasser kostenfrei an, „und meistens wird das dankbar angenommen“. Um 15 Uhr ist Feierabend, „denn am Nachmittag gehen viele nach Hause, schlafen eine Runde, bevor es dann wieder auf die Gass‘ geht“.
Die, die es nicht mehr bis zum Mittagsschlaf im heimischen Bett schaffen, sondern aufgrund ihres hohen Alkoholkonsums schon im Laufe des Morgens auf der Straße ihre (verdrehten) Augen schließen, landen in der Regel im Behandlungszimmer der Kinderklinik.
„Hierher kommen die ganz krassen Fälle“
Oberarzt Andreas Böckmann nimmt sie in Empfang. „Bevor es die Notfall-Präventionsteams gab, wurden sämtliche aufgefundenen betrunkenen Jugendlichen direkt bei uns eingeliefert“, berichtet Böckmann. „Heute kommen in der Regel nur die ganz krassen Fälle, die wirklich unsere Hilfe benötigen.“ Die Teams und Sanitäter sortieren minder schwere Fälle vorab aus, versuchen die Eltern zu kontaktieren und leisten damit wertvolle Arbeit.
In Andreas Böckmanns Augen sind die selbst gemischten Getränke ein großes Problem. Alkopops waren Anfang des Jahrtausends bei Jugendlichen beliebt. Sie bestehen aus Spirituosen und Limonade, enthalten etwa 5,5 Prozent Alkohol und sind erst ab 18 Jahren erlaubt. 2004 wurde die Alkopopsteuer eingeführt. Seitdem kostet eine Flasche etwa einen Euro mehr – der Verbrauch ging rapide zurück. „Heute besorgt man sich eine Flasche Cola und eine Flasche Wodka und vermischt das selbst“, erzählt Andreas Böckmann. „Somit nehmen die Jugendlichen eine unberechenbare Menge Alkohol auf. Durch den süßen Geschmack merken sie gar nicht, wie stark das Zeug ist. Sehr gefährlich.“
Saufen nur die Jungs? „Die Mädels haben mächtig nachgezogen“
Vor rund 20 Jahren seien noch vornehmlich männliche Kampftrinker unterwegs gewesen, „doch die Mädels haben mächtig nachgezogen. Heute liegt ihr Anteil bei rund 50 Prozent“. Auch beobachte er einen „klaren Trend, dass die eingelieferten Patienten immer jünger werden. Wir haben schon dreizehnjährige Mädels, die wir hier aufnehmen müssen“. Vor ein paar Jahren habe er eine 16-jährige Patientin gehabt, die vier Promille hatte. „Das war aus medizinischer Sicht wirklich eindrücklich.“

In bedenklichen Fällen, wenn also Jugendliche mit hohem Promille-Wert eingeliefert werden, hat die Klinik Methoden der Abschreckung – und zum Schutz der eigenen Mitarbeiter. Zunächst einmal wird den Patienten eine Windel angezogen. „Ich kann unseren Pflegerinnen ja nicht zumuten, dass sie das Bett anschließend eingenässt abziehen müssen“, erklärt Andreas Böckmann. „Den Jugendlichen ist das sehr peinlich, wenn sie irgendwann wieder zu sich kommen.“
„Eine unästhetische Angelegenheit“
Die jungen Mädchen, die aufgrund ihrer körperlichen Konstitution weniger vertragen, bekommen mit ihren Betten den Platz an der Wand. „Die dürfen dann am nächsten Morgen ihr Erbrochenes von der Wand komplett selbst wegwischen. Das ist eine extrem unästhetisches Angelegenheit.“
„HaLT – Hart am Limit“
Wenn diese zutiefst unangenehmen Situationen noch nicht genug waren – spätestens beim Aufklärungsgespräch mit den Eltern kommen manche Jugendliche vielleicht auf die Idee, dass der unkontrollierte Vollrausch am Schmotzigen Dunschtig nicht die beste Idee war, wie Andreas Böckmann erzählt: „Wir nehmen teil beim Programm ‚HaLT‘, was hart am Limit bedeutet, einem Alkohol-Präventionsprogramm. Unsere Fachkräfte sprechen hier mit Jugendlichen nach einer Alkoholintoxikation und klären sie auf.“

Gemeinsam wird in diesem Gespräch überlegt, wie so ein Erlebnis in Zukunft vermieden werden kann. Mit den Eltern werden dann Regeln und Richtlinien für den Umgang mit dem Thema Alkohol in der Familie erarbeitet. Dabei ist eine Vertrauensbasis ist wichtig: Die Fachkräfte unterliegen der Schweigepflicht, auf Wunsch kann das Gespräch mit dem Jugendlichen ohne die Eltern erfolgen.
„Stolz darauf, wie besoffen sie waren“
„Meistens sind die Betroffenen am Tag danach einsichtig“, erzählt der Oberarzt. Andreas Böckmann hat aber auch schon schlechte Erfahrungen gemacht: „Es gibt Jungs, die rufen noch vom Krankenbett aus mir ihrem Handy Freunde an und sagen ganz stolz, wie besoffen sie mal wieder waren.“ Richtig problematisch sei es, wenn die Eltern selbst die Situation herunter spielen würde, oder, noch schlimmer, „wenn sie mit einer Fahne kommen, um die Tochter oder den Sohn abzuholen, und sagen: ‚Ach was, halb so schlimm. Ich habe früher auf der Fasnacht auch getrunken‘“.
„Ein Freibrief für alle, sich voll laufen zu lassen“
In solchen Fällen liegt der Schluss nahe, woher der Hang zum übermäßigen Konsum kommt, wie Irene Jun vom Jugendamt schlussfolgert: „Man bekommt schnell den Eindruck, als sei der Schmotzige Dunschtig ein Freibrief für alle, sich voll laufen zu lassen. Erwachsene sollten ja auch eine Art Vorbildfunktion einnehmen.“