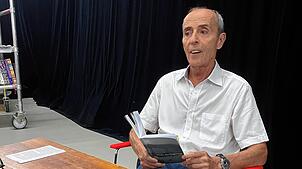Seit Donald Trump und Wladimir Putin dabei sind, sich die Welt untereinander aufzuteilen, hat der Begriff des Kolonialismus eine neue Aktualität bekommen. Und damit auch der Roman einer argentinischen Schriftstellerin namens Sara Gallardo, der 1979 veröffentlicht wurde. „Eisejuaz“ erzählt die Geschichte eines Indigenen, der in einer Mission aufwächst, aber auch mit der Kultur seines Volkes verwurzelt ist, was zu einer inneren Zerrissenheit führt. Zugleich ist er mit der Zerstörung seines Lebensraumes, mit Ausbeutung und rassistischer Demütigung konfrontiert.
Beat Furrer hat den Roman zur Grundlage seiner Oper „Das große Feuer gemacht“, die nun im Opernhaus Zürich uraufgeführt wurde (Libretto: Thomas Stangl). Sucht man nach Gegenwartsbezügen, geht der Stoff über das Thema Kolonialismus noch weit hinaus. Was Furrer daran interessiert hat, ist die Entfremdung von Mensch und Natur, die im Klimawandel resultiert. Und für die Regisseurin Tatjana Gürbaca ist das Buch nicht nur eine Geschichte über Kolonisation und den Verlust der Natur, sondern: „Eigentlich sind wir alle dieser Eisejuaz.“
Lauter woke Themen
Eine Oper also über Klimawandel, Kolonialismus, Rassismus, Natur- und Kulturverlust? Das klingt fast schon so woke, dass sich dahinter neue Fallstricke auftun: die der kulturellen Aneignung. Die heile indigene Welt gegen die ausbeuterische Kultur der Weißen? Diesen Verdacht kann der Komponist allerdings schnell ausräumen: „Meine Oper ist keine exotische Fantasie, dafür ist der Stoff zu voll von harter sozialer Realität.“ Nicht einmal ansatzweise greife er Klänge der Indigenen auf.
Tut er tatsächlich nicht. Der gebürtige Schweizer bleibt bei seiner ganz eigenen Musiksprache der oft (allerdings keineswegs ausschließlich) leisen, differenzierten Klangsprache. In seiner Musik kommt es zwar auch zu Ausbrüchen, aber oft brodelt es unter der Oberfläche. Die innere Unruhe, die die Hauptfigur Eisejuaz (genial verkörpert durch Leigh Melrose) umtreibt, wird so sehr gut spürbar.
Zudem kombiniert Furrer gerne die Klangextreme – sehr hohe Flageolett-Töne und tiefe brodelnde Klänge im Subkontrabass-Bereich, beides fast schon an der Wahrnehmbarkeitsschwelle, so dass man das Ergebnis mehr spürt als hört.
Eine besondere Bedeutung kommt dem Vokalensemble (das in Graz beheimatete Ensemble Cantando Admont) zu, dessen Aufgaben weit über die eines gängigen Opernchors hinausreichen. Es ist ein Kollektiv im ständigen Wandel, fliegende Kostümwechsel inklusive (Kostüme: Silke Willrett), erweitert mal den Orchesterklang, stellt mal die magischen Stimmen von Bäumen und Tieren dar, mal die inneren Stimmen des Eisejuaz.
Es flüstert und schreit, ist aufrührerisches Volk und übernimmt immer wieder auch einzelne Solopartien. Eine Mammutaufgabe, die das mit Furrers Musik vertraute Ensemble scheinbar mühelos meistert.
Reste des gerodeten Walds
Furrer zielt damit auf eine Auflösung einer streng linearen Erzählweise zugunsten einer Art Gleichzeitigkeit von Ereignissen, wie sie auch der Roman verfolgt – und was Tatjana Gürbaca und ihre Co-Regisseurin Vivien Hohnholz ebenfalls aufgreifen. Die passende Bühne dazu liefert Henrik Ahr. Es ist eine Drehbühne, die Stangen darauf mögen an die Reste des gerodeten Walds erinnern.
Auf dieser Scheibe versammelt sich Eisejuaz‘ gesamte Welt, in der er nun von einem zum nächsten hetzt. Er kümmert sich um seine todkranke Frau, wird bedrängt, angefeindet, verführt, begegnet Pfarrer, Seherin und Schamane und will zugleich noch helfen.
Nach einer Gottesbegegnung im Ausguss einer Hotelspüle glaubt er, eine Tat der Nächstenliebe vollbringen zu müssen und trifft ausgerechnet auf Paqui (Andrew Moore), einen unerbittlichen Rassisten, der Indios verachtet. Dieser wird ihn am Schluss verraten, indem er Eisejuaz‘ Hilfe als Überfall darstellt – das Thema Fake News wäre also auch noch ein Anknüpfungspunkt für die Regie gewesen.
Ein Getriebener
Gürbaca und Hohnholz zielen allerdings auf Zeitlosigkeit. Die Handlungselemente werden dabei reduziert und abstrahiert. Kein Klimawandel und wenig Kolonialismus also (außer des teils spanischen Librettos erinnert wenig an Lateinamerika), zumindest nicht vordergründig. Was bleibt, ist Eisejuaz und seine Getriebenheit.
Darin ist er ein Verwandter von Büchners Woyzeck, der ebenfalls ausgebeutet und gedemütigt wird und übrigens auch Stimmen hört. Doch während Woyzeck seine Freundin Marie umbringt, stirbt Eisejuaz umgekehrt durch die Hand seiner Vertrauten Muchacha (Sarah Aristidou) – wenn auch durch ein tragisches Versehen.
Reizvoll, und dennoch...
Der Weg bis zu diesem Punkt ist lang. Die ineinanderfließenden Szenen bleiben oft skizzenhaft und sind ohne die Hilfestellung der inhaltlichen Angaben in den Übertiteln nicht immer verständlich. Die Musik hat durchaus ihren Reiz, erinnert gelegentlich an die entrückten Sopranpassagen eines Nono, an die dichte Geräuschwelt eines Lachenmann und in der Stimmführung an Salvatore Sciarrino.
Und doch wird man mit diesem Opernabend nicht ganz glücklich. Zu sperrig bleibt er, zu wenig trägt die Dramaturgie über zwei Stunden hinweg, zu unklar bleibt, worauf genau das Stück hinaus will.
Weitere Aufführungen: 25., 28., 30. März; 4.6.11. April. www.opernhaus.ch