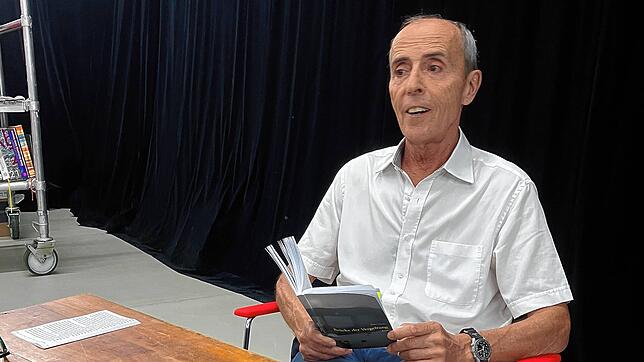Herr Sommer, gab es die Idee zum ersten Krimi schon länger?
Walter Sommer: Zum einen setzte ich mich selbst unter Druck, weil ich gegen Ende meiner Amtszeit angekündigt hatte, neben einem Sachbuch auch einen Kriminalroman zu schreiben. Zum anderen trug ich seit Längerem zwei, drei Szenen mit mir herum, die sich aber noch nicht zu einer Geschichte fügten. Dann kam der Plot plötzlich wie von selbst: Ich wollte über Recht und Gerechtigkeit schreiben, mit dem Schwerpunkt auf der eigenmächtigen Sühne von Schuld. Wichtig war mir, die Leserinnen und Leser nicht zu bevormunden; am Ende soll jede und jeder die Antworten in sich selbst finden.
Wie viel Zeit haben Sie für Recherche aufgewendet?
Walter Sommer: Meine Recherchen betrafen Details zu bereits vertrauten Ereignissen. Der Aufwand blieb zeitlich überschaubar und war für mich eine spannende Arbeit – ein wesentlicher Teil des schriftstellerischen Handwerks. Man stößt von einem Thema zum nächsten, hinterfragt und ergänzt. Ich nutzte ausschließlich öffentlich zugängliche, elektronische Quellen. Zu Beginn gab es noch keine KI-Unterstützung; erst einige Zeit nach deren Aufkommen setzte ich sie ein, weil sich damit präzise Fragen schneller beantworten ließen, ohne lange suchen zu müssen.
Das stilistische Mittel des Kriminalromans sorgt für Spannung, Rätselhaftigkeit oder den Blick auf Moral, Schuld, Sühne, Gerechtigkeit und Wahrheit. Was ist das Brisante an diesem Kriminalroman?
Walter Sommer: Besonders ist, dass man die Mörder von Beginn weg kennt. Das Brennende ist die Frage, ob und wie es dem Verhörrichter und der Polizei gelingen wird, die Täter zu überführen. Drängend und in den Roman hineinziehend jedoch auch, wie die Täter selbst mit ihrer Schuld umgehen, wie sie ihre Taten rechtfertigen.
Welche Rolle spielt die Brücke zwischen Diessenhofen und Gailingen?
Walter Sommer: Es geht schon um Diessenhofen-Gailingen. Mehr oder weniger jeder Roman ist örtlich irgendwo angesiedelt, wobei ich das Lokalkolorit von Anfang an sah. So konnte ich die in mir aufgenommen Überlieferungen und meine eigenen Erfahrungen nutzen. Für mich steht fest, dass man über nichts schreiben kann, wenn es nicht Teil der eigenen Seele ist.
Welche Rolle spielen Ihre Wurzeln mütterlicherseits nach Gailingen?
Walter Sommer: Natürlich fühlt man sich dem Nachbarort bei dortigen familiären Wurzeln verbundener, mehr aber doch nicht. Vom punktuellen Wissen her sind es Mutters Erzählungen, etwa wie sie als Schulmädchen in einer strenggläubigen jüdischen Familie während des Sabbats so ziemlich alle Arbeiten verrichtete oder später auch, wie die jungen Frauen in Gailingen Wehrmachts-Uniformen nähten, wobei sie für die Soldaten kurze Liebesbotschaften oder einfach gute Wünsche auf Papier in die Nähte stückelten.
Welche Rolle spielt der Austausch mit den Gailinger Juden während der NS-Zeit in Diessenhofen in Ihrem Krimi?
Walter Sommer: In Gailingen lebten Juden, die ihre Geschäfte in Diessenhofen betrieben – nachvollziehbar, weil es dort einen Bahnanschluss gab. Das Zusammenleben verlief weitgehend reibungslos; man sagt, sie waren „gut gelitten“. Dennoch ließ sich wirtschaftliche Konkurrenz nicht leugnen, und dabei geriet man mitunter aneinander. Die jüdischen Firmenchefs überquerten täglich mit ihren Mitarbeiterinnen die Brücke zur Arbeit, bis diese 1942 geschlossen wurde. Zogen sie nach Diessenhofen, hielten sie weiterhin Kontakt zur jüdischen Gemeinschaft in Gailingen.
Beinhaltet Vergeltung im Roman den Wunsch, das erlittene Unrecht auszugleichen oder geht es um Vergeltung fürs begangene Unrecht?
Walter Sommer: Tatsächlich setzten sich auch die Täter im Roman inneren und äußeren Auseinandersetzungen aus, es waren Hass, Zorn und Verbitterung, wobei ich die Rache als solche ausschließen wollte, das wäre mir ein allzu verächtliches Motiv gewesen. Im Vordergrund stand das Herstellen von später Gerechtigkeit, einer Genugtuung auch oder zur eigenen und gesellschaftlichen Beruhigung. Der Fokus der Gesetzesbrecher, so steht es im Roman, lag darauf, dass die Täter aus der Nazizeit endlich zur Rechenschaft gezogen wurden; weniger darauf, Personen zu bestrafen, als vielmehr deren Taten zu sühnen.
Es geht um zwei Geschichtsepochen – Kriegs- und Nachkriegszeit? Welche Rolle spielt die Nachkriegszeit?
Walter Sommer: Die Aufklärung hat offenbar bis heute bei vielen wenig bewirkt. Selbst im Zweiten Weltkrieg gab es hierzulande eine hitlerfreundliche „Nationale Front“. Der Roman spielt, was die Vergeltungstaten betrifft, im Jahr 1970. Auch damals war Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz deutlich spürbar, wie die Debatte über die Initiative der „Nationalen Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat“ zeigt (sie zielte auf die Abschiebung italienischer Gastarbeiter). Die Morde geschahen teils öffentlich – es ging also auch ums Vergessen. Versöhnung statt Vergeltung wäre ethisch edler, doch ich halte auch „Versöhnung durch Vergeltung“ für denkbar: Vergeltung beruhigt und schafft Ausgleich. Sie ist eine Form der Sühne – genau darauf zielt auch der Staat mit Strafen. Beide, Versöhnung wie Vergeltung, sind bewusste Anstrengungen, die eine Lösung bringen und das endlose „Man müsste, man sollte“ beenden. Offen bleibt die Frage nach einer Sühne, die nach heutigem Recht unzulässig wäre, zumal wenn sie in einem Exzess erfolgt. Zum Nachdenken: Die Bibel kennt „Auge um Auge“; noch vor kurzem waren Fehden und Blutrache verbreitet; und manche Glaubensgemeinschaften erlauben bis heute, unter Aufsicht der Gerichte, persönliche Vergeltung.
Wie sehen Sie den Umgang mit dem historischen Erbe heute?
Walter Sommer: Die Zeit heilt Wunden, birgt aber auch die Gefahr des Vergessens in sich. Der Antisemitismus, der Fremdenhass, sie dürfen nie salonfähig werden. Es wird darum gehen, auch wenn es sich schon beinahe wie eine Platitude anhört, das Geschehene immer in Erinnerung zu behalten.
Warum die Verknüpfung Drittes Reich – Kriminalroman und nicht ein historisches Buch?
Walter Sommer: Weil ein Krimi von einem breiteren Publikum eher gelesen wird und sich im Zusammenhang mit dem Dritten Reich beidseitig des Rheins viel Böses als Ausgangspunkt finden lässt.