Tobias, von allen Tobi genannt, ist elf Jahre alt. Zusammen mit seinen Eltern wohnt er in einem ländlich geprägten Vorort von Köln, sein Vater arbeitet als Ingenieur und seine Mutter ist Hausfrau. Es ist der Sommer 1969, und die Apollo-11-Mission, die Landung der Amerikaner auf dem Mond, steht bevor.
Mit seinem Vater fiebert Tobi ihr entgegen, es ist für ihn das bisher aufregendste Erlebnis in seinem jungen Leben. Dann aber ziehen die Leinhards in das leer stehende Haus auf dem Nachbargrundstück ein – ein Ehepaar mitsamt seiner 13-jährigen Tochter Rosa – und binnen Kurzem verändert sich alles.
Die konservative westdeutsche Wirtschaftswunder-Gesellschaft der späten 1960er-Jahre porträtiert Ulrich Woelk (Jahrgang 1960, also damals kaum jünger als Tobi, sein Ich-Erzähler) mit scharfem, oft aber auch von einer unterschwelligen Nostalgie geprägtem Blick.
In der bürgerlichen Kleinfamilie herrschte seinerzeit noch eine althergebrachte, klare Rollenverteilung. Der Mann sorgte für den materiellen Grundstock, sprich: das Haushaltseinkommen. Für die Ehegattin gab es die drei K‘s – Küche, Kirche, Kinder.
Die neuen Nachbarn
Tobis neue Nachbarn sprengen diese Grundstruktur drastisch: Zwar könnte Herr Leinhard als Philosophieprofessor mühelos eine mehrköpfige Familie allein ernähren, aber seine Frau arbeitet dennoch ebenfalls – als Übersetzerin für einen Buchverlag. Als sie mitbekommt, dass Tobis Mutter ganz gut Englisch kann, überredet sie sie dazu, es auch einmal probeweise bei ihrem Verlag zu versuchen.
Zu allem Überfluss sind die Leinhards auch noch überzeugte Kommunisten und und bewegen sich damit im ländlich-katholischen Milieu des westdeutschen Teilstaats hart am Rande einer Außenseiter-Existenz, aber Tobis Eltern und sie freunden sich dennoch an.
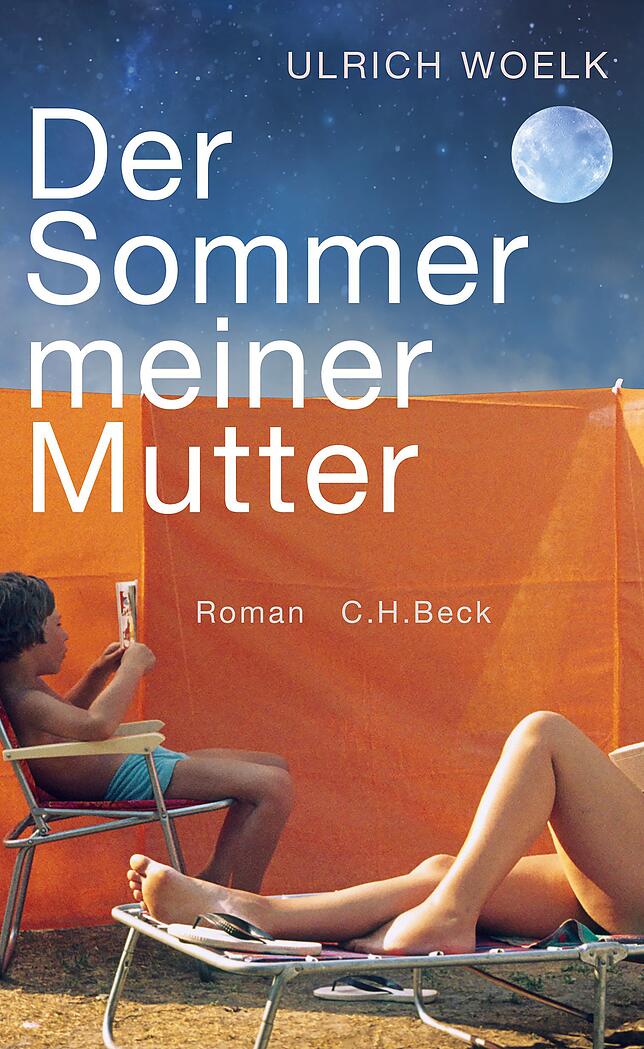
Auch Tobi und Rosa kommen sich näher, und der schüchterne Junge entdeckt, dass es noch ganz andere aufregende Abenteuer zu erleben gibt, als sich am Fernseher die Mondlandung anzugucken.
Das Mädchen macht ihn – der bisher deutsche Schlager goutierte – mit angloamerikanischer Rockmusik bekannt, weckt seine Liebe zu The Doors und ihrem Album „Waiting For The Sun“, erläutert ihm ganz nebenbei, dass die Amerikaner einen verbrecherischen Krieg in Vietnam führen, und klärt ihn darüber auf, was das eigentlich ist, worüber die älteren Jungs in der Schule hinter vorgehaltener Hand reden.
Alles verändert sich
Die Eltern der beiden sehen die sich anbahnende Freundschaft zwischen ihren Sprösslingen mit Wohlwollen – sozusagen als Parallel-Entwicklung zu ihrer eigenen Annäherung …
Subtil, anfangs fast unmerklich, verändert sich alles: In Köln eröffnet der erste Laden, der ausschließlich Blue Jeans führt. Tobis Mutter bekommt tatsächlich einen Job als Englisch-Übersetzerin, beginnt aber deshalb, ihre traditionellen hausfraulichen Pflichten zu vernachlässigen.
Die Dinge nehmen ihren Lauf
Ihr Mann schenkt ihr in einem Anfall von Akzeptanz des offenbar unvermeidlichen Laufs der Dinge zum Geburtstag einen gebrauchten Citroën 2CV, mit ihm kurvt sie nun durch die Landschaft. In Köln findet die erste Anti-Vietnamkriegs-Demonstration überhaupt statt, Tobis und Rosas Mütter nehmen mitsamt ihren Kindern daran teil.
Wer dieser Ho Chi Minh ist, dessen Namen die aufsässigen Studenten und Schüler skandieren, weiß Tobi zwar nicht so genau, aber das ist ihm auch gar nicht wichtig, wichtig ist nach wie vor die Mondlandung – und Rosa.
Sommer endet tragisch
Bei Woelk endet er tragisch, dieser bemerkenswerte Sommer ‚69 (wie übrigens bereits aus dem ersten Satz des Romans hervorgeht). Die neuen individuellen und gesellschaftlichen Freiheiten, die damals auf breiter Front teils erkämpft wurden, teils unaufhaltsam in die bürgerlich-konservativen Grundstrukturen einsickerten – das Recht der Frauen auf Gleichstellung und Selbstverwirklichung, die sexuelle Revolution, die Infragestellung des traditionellen Autoritarismus – sie sind nicht immer einfach zu managen.
Revolution für alle
Im Fall von Tobis und Rosas Familien führen sie schnurstracks in die Katastrophe. Meisterhaft schildert Woelk, wie die mentale Revolution, die im Mythen-Jahr 1968 zumindest in Deutschland auf eine relativ kleine Minderheit von Aktivisten hauptsächlich aus dem urbanen studentischen Milieu beschränkt geblieben war, zwölf Monate später die Gesellschaft in ihrer gesamten Breite erfasste – in den Mittel- und Kleinstädten, auf dem flachen Land.
Alles gehörte damals zusammen: Rockmusik, Jeans, lange Haare, Citanes-Zigaretten, sexuelle Freizügigkeit und eine militant-pazifistische Grundeinstellung.
Ulrich Woelks Geschichte dieses außergewöhnlichen Jahres endet noch im Sommer, das Sahnehäubchen auf diesem beispiellosen Prozess einer gesellschaftlichen Umwälzung findet deshalb bei ihm keine Erwähnung mehr: die Ersetzung des ehemaligen NSDAP-Mitglieds und Mitarbeiters im Nazi-Außenministerium Kurt Georg Kiesinger im Amt des Bundeskanzlers durch den nach Hitlers Machtübernahme ins Ausland geflohenen antifaschistischen Ex-Journalisten Willy Brandt – nach dem Wahlsieg von SPD und FDP im September.
Auch auf der Ebene der etablierten Politik war das Land damit urplötzlich nicht mehr wiederzuerkennen.







