In einer Gesellschaft, die verlernt hat zwischen Welt und Bühne zu unterscheiden, ist Lisa Eckhart eine Zumutung. In der Welt geht es darum, Antworten zu finden und Haltung zu zeigen. Die Kunst dagegen lebt von offenen Fragen und einem Bekenntnis zur Uneindeutigkeit: Wer das nicht kann, produziert bloß Gesinnungs-Propaganda, und davon gibt es zurzeit reichlich.
Lisa Eckhart ist eine Kunstfigur der 27 Jahre alten österreichischen Kleinkünstlerin Lisa Lasselsberger. Sie kleidet sich mondän, gebärdet sich extravagant, und was sie sagt, ist irritierend, böse, unverschämt. So ist das mit Kunstfiguren, Mephisto möchte man sich auch nicht zum Kaffee einladen. Man möchte hoffen, dass Frau Lasselsberger privat verträglicher ist als Lisa Eckhart.
Antisemitischer Witz, rassistische Bemerkung
Jetzt ist unter dem Namen dieser Kunstfigur ein Roman erschienen. Eifrige Vertreter der Gesinnungs-Propaganda nahmen dies zum Anlass, Eckharts Bühnenauftritte nach Spurenelementen von Diskriminierung zu durchforsten. Ist hier nicht ein antisemitischer Witz gefallen? Gibt es dort nicht eine rassistische Bemerkung? Kontext, Inszenierung, Bühnensituation: Das alles zählt nicht, wenn Tugendwächter auf Streife gehen.
Und so kam es zu einem Literaturskandal, als in Hamburg ein Festivalveranstalter glaubte, die vermeintlich des Antisemitismus überführte Künstlerin kurzerhand ausladen zu müssen. Zum Glück gibt es gegen solche Versuche der Beschneidung von Kunstfreiheit noch Widerstand. Die inzwischen entstandene Aufregung dürfte der Autorin jedenfalls mehr Ruhm einbringen, als ihren Gegnern lieb sein kann.
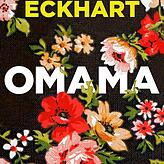
Wie aber ist er nun, der Roman von Lisa Eckhart?
Sein Titel „Omama“ verweist auf eine Heldin aus der Kriegsgeneration, die Großmutter der Ich-Erzählerin. Wir erfahren von ihrem Leben in der österreichischen Provinz, vom Alltag unter russischer Besatzung und später als Hilfskraft in einer Gaststube. Das Besondere daran: Wir erfahren davon ganz ohne Zuckerguss. Und das ist gewagter, als man annehmen könnte.
So findet die klassische Setzung von keuschen österreichischen Jungfrauen einerseits und rachedurstigen russischen Vergewaltigern andererseits eine brisante Umkehrung. Die junge Helga – anders als ihre schöne Schwester Inge von den Jungs im Dorf verschmäht – sieht in der Ankunft der Besatzer ihre große Chance gekommen: Endlich wird sie einen Mann abkriegen!
Zeit für zwischengeschlechtliche Abenteuer
Überhaupt zeigt sich das als frömmlerisch verschriene Landleben der Nachkriegszeit von seiner deftigen Seite: Ständig sorgt man sich um ausreichend Gelegenheiten für zwischengeschlechtliche Abenteuer, da wird „gebrunzt“ und „gesaftelt“, dass es eine wahre Freude ist.
Und als die russischen Soldaten an den jungen Frauen kaum Interesse zeigen, sorgt das für Ernüchterung statt Erleichterung. Von Verhütung haben die meisten Dorfbewohner ebenso wenig Ahnung wie von den Geheimnissen der Menstruation, doch das liegt weniger an ihrer Sittsamkeit denn an verbreiteter Unbildung.

Es ist eine Welt, die so gar nichts mit den heutigen Empfindlich- und Schamhaftigkeiten gemein hat: Dorfdepp und Dorfmatratze gehören hier noch ebenso selbstverständlich zur Gemeinschaft wie der Dorftrinker. Anonym bleiben zu müssen, brächte diesen wohl um sein Lebensglück, beansprucht er doch „den besten Platz an der Budel, mit Panoramablick auf die Wirtin“. Sie alle spielen ihre Rolle, jeder wird gebraucht: Und sei es nur als Sündenbock oder mahnendes Beispiel.
In wilden Assoziationsketten lässt sich Eckhart immer wieder forttreiben aus dieser Vergangenheit, hin in eine so ganz andere Gegenwart. Dann wird im Vergleich blitzartig die Verlogenheit manch vermeintlicher Errungenschaft sichtbar: etwa wenn Menschen statt zum Nachbarn am Kneipentresen bloß noch in Mailboxen sprechen oder auf Fernreisen nach „Erlebnissen“ suchen, statt überhaupt erst mal zu leben.
Ermüdend statt mitreißend
Im besten Fall zeigt sich darin der enorme Sprachwitz dieser Autorin, leider aber führen diese Exkurse nicht immer zu Erkenntnis. Dann droht der virtuose Wirbel seinen staunenden Betrachter mehr zu ermüden als mitzureißen.
Die Großmutter schlägt sich durch die Zeiten mit Bauernschläue und Dreistigkeit, erweist sich als eine Lebenskünstlerin, wie man sie sich in der heute allseits grassierenden Verkopft- und Verzagtheit kaum mehr vorstellen mag. Am Beispiel ihrer Vergangenheit blickt der Leser mit kritischen Augen auf seine eigene Gegenwart. Doch so sympathisch diese Grundidee des Romans auch ist und so schlüssig ihre Umsetzung zu Beginn noch wirkt: Über die volle Distanz trägt sie nicht.
Enttäuschend ist das vor allem deshalb, weil ein weitaus größeres Potenzial aus diesem Buch erkennbar wird. „Omama“ ist vielleicht nicht das erhoffte brillante Debüt, es ist aber gelungen genug, um sich mehr Literatur von dieser Autorin zu wünschen.







