Musik sprengt bekanntlich Grenzen, errichtet Brücken und ist auch sonst für jeden Kalenderspruch zu haben. Insbesondere der Klassikbetrieb hat mit seiner Verklärung von Musik zur ultimativen Seelentrösterin und Heilsbringerin viel Schaden angerichtet. Wo so himmlisch musiziert wird, lautet nämlich eine bis heute wirkmächtige Erzählung, da sei fürs Böse gar kein Platz: Despoten mit Taktstock und übergriffigen Opernstars bietet dieses Narrativ den idealen Schutzraum.
Der Schriftsteller Christopher Kloeble, als Kind Mitglied des Tölzer Knabenchors, hatte sich zuletzt mit deutlicher Kritik an dieser Institution zu Wort gemeldet. Von Demütigungen, emotionaler Gewalt und brüllenden Dirigenten wusste er zu berichten. Die Erfahrung eines Klimas von ständiger Angst hat auch schon in seine Literatur Eingang gefunden, etwa bei seinem Buch „Home. Made in India“.
War Beethoven eine Frau?
Jetzt hat Kloeble einen Roman geschrieben, dessen Protagonistin in den beginnenden 90er-Jahren Mitglied eines Knabenchors wird. Und vom Verlag vorab nach ihrem Lektüreeindruck befragte Buchhändler sind voll des Lobes für diese „berührende“ Geschichte über die „Liebe zur Musik“, was sie alles „auszudrücken“ vermag, wie sie „begeistern“, wen sie „stark machen“, wo sie „Hoffnung schenken“ könne. Wirklich?
Die 13 Jahre alte Arkadia Fink ist Tochter einer exzentrischen Komponistin. Sie hört ausschließlich klassische Musik, vor allem aber das Werk Beethovens, der in Wahrheit eine Frau gewesen ist. So jedenfalls hat sie es von ihrer Mutter gelernt, so sieht sie es selbst.
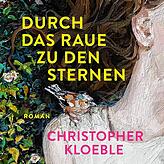
Das könnte als erfrischend feministische Kulturkritik durchgehen, wie man überhaupt im jugendlichen Interesse für klassische Musik eine erfreuliche Weltoffenheit erkennen möchte. Doch Offenheit ist das Letzte, was sich mit dieser Romanfigur verbinden ließe. Vor Kontakt mit anderen Kindern schützt sie der Kopfhörer ihres Walkmans. Klassenkameraden straft sie ebenso mit Verächtlichkeit wie das Lehrpersonal oder den Busfahrer. Ihre nach eigener Auskunft „beste Freundin“, natürlich Musiklehrerin, lebt im Seniorenheim. Man weiß nicht recht: Lebt dieses Mädchen so, weil sie autistisch veranlagt ist? Oder ist im Gegenteil ihre weltabgewandte, zwanghafte Persönlichkeit Ausdruck dieses Lebens?
Jedenfalls setzt Arkadia, die von ihrer Mutter früh den Rufnamen „Moll“ verpasst bekommen hat, alles daran, „eine überragende Persönlichkeit der Musikgeschichte“ zu werden. Und weil diese Klassik-Übermutter aus unerfindlichen Gründen seit Tagen verschwunden ist, muss dem Mädchen nun der örtliche Knabenchor helfen, dieses Ziel zu erreichen. Mit halb stoischer, halb manischer Konsequenz erzwingt sie allen Regeln zum Trotz erst ihre Einladung zum Vorsingen, dann sogar ihre Aufnahme.
Der Autor
Interessant ist nun, wie Koelble nicht etwa sie am Betrieb zerschellen lässt, sondern eher umgekehrt den Betrieb an ihrer Person. Die Gesangslehrerin lässt sie erst mal wissen, dass etwas mit ihren Ohren nicht stimmt, weil sie schlecht höre, aber auch mit ihrer Haltung, weil sie schlecht atme und überhaupt: Als Lehrerin sei sie nicht zum Loben da, sondern zum Aufholen vergeudeter Jahre der Stimmbildung – was aber in Molls Fall wohl völlig aussichtslos sei. Und das Kind? Steckt das alles einfach ein. Zweifelt nicht, weint nicht, übt einfach weiter wie ein Automat. Schluckt die Angriffe, als handele es sich um Smarties.
Vielleicht offenbart sich darin ja tatsächlich so etwas wie das Idealbild eines Sängerknaben: isoliert in seiner eigenen Welt, gleichgültig gegenüber dem Urteil anderer Menschen, allein dem eigenen großen Ziel verpflichtet. Und schon per Geschlecht ein Solitär in einem Meer von Gleichen. Nur wer so ist, so stur, so autonom, so abgeschottet, kann sich auch selbst ermächtigen und „durch das Raue zu den Sternen“ gelangen: Mitten im Konzert düpiert Moll mit einem improvisierten Solovortrag ihren Dirigenten und singt sich in den Kulturteil der Lokalzeitung. Aber das hat nichts von „Brückenschlagen“ und „Hoffnung schenken“. Eher von Kopf-durch-die-Wand.
Es ist ein hochproblematisches Musikverständnis, das Koelble hier mit leiser Ironie und trockenem Wortwitz offenlegt. Eines, das schon die Mutter in einer entrückten Kunstwelt um sich selbst kreisen lässt – während ihr bodenstämmiger Handwerker-Ehemann hilflos um Ausgleich ringt.
Man ahnt, dass dem Verschwinden dieser Mutter seelische Probleme zugrunde liegen. Und fürchtet, dass der Tochter mit ihrem vollständigen Absorbieren dieser Musik-Ideologie langfristig kaum geholfen sein dürfte. Wenigstens ein Schicksal aber bleibt der jungen Arkadia alias Moll wohl erspart: nämlich eine überragende Persönlichkeit der Musikgeschichte zu werden. Glücklich sind von denen nur die wenigsten geworden.







