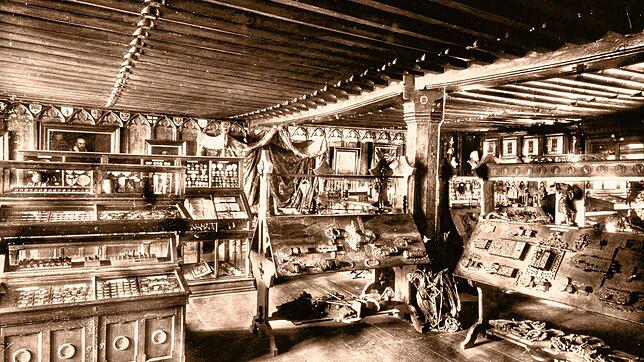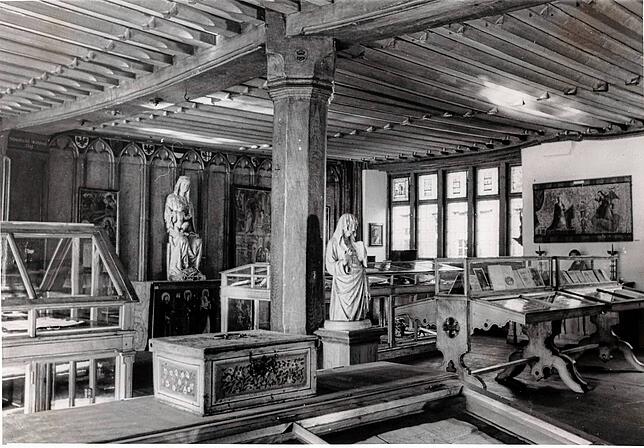Man muss nicht die „Education-Officer“ und „Digital-Manager“ bemühen: Schon ganz selbstverständliche Berufsbilder der heutigen Museumslandschaft wie etwa Restauratoren, Konservatoren oder Kuratoren hätten im 19. Jahrhundert vielerorts wohl ebensoviel Erstaunen ausgelöst wie die heutigen Präsentations- und Archivierungsstandards.
Im Konstanzer Rosgartenmuseum zum Beispiel herrschte noch bis ins 20. Jahrhundert hinein stellenweise der Charme einer Rumpelkammer. Und statt eines hauptamtlichen Konservators rührte ein Apotheker die benötigten Tinkturen an.
Was waren das für Leute?
Museen, darunter hatte man lange Zeit die Kunst- und Wunderkammern des Hochadels verstanden: Speicher und Repräsentationsorte vor allem für die auf Kriegszügen erbeuteten Kunstwerke, Schmuckstücke und Waffen. Dass Sammeln, Forschen und Bewahren sich auch aus Gründen der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung lohnen könnte, statt nur zur politischen Machtdemonstration, das war ein neuer Gedanke. Was waren das für Leute, die dieser Idee anhingen? Und vor allem: Warum taten sie das?
Die Gründung des Rosgartenmuseums liegt nun 150 Jahre zurück. Museumschef Tobias Engelsing nimmt das zum Anlass, bislang selten gezeigte Objekte aus dem eigenen Bestand zu präsentierten und dabei auch die ersten Jahre in der Geschichte des Hauses zu beleuchten.
Letzteres ist schon deshalb interessant, weil die Gründung des Rosgartenmuseums aus gleichermaßen typischen wie eher ungewöhnlichen Motiven dieser Zeit resultierte. Typisch ist das Entstehen der bürgerlichen Sammelleidenschaft aus der nationalliberalen Einigungsbewegung. Wurzeln einer gemeinsamen deutschen Identität finden, Heimaterzählungen weitergeben als Kitt für einen zu erschaffenden Staat: Das ist im 19. Jahrhundert Antrieb beinahe jeglichen politisch kulturellen Handelns in den deutschsprachigen Fürstentümern gewesen.
Am Bodensee waren es die Überreste der Pfahlbauten, die das Sammelfieber entfachten. Lehrer, Pfarrer, Bauern: Sie alle griffen bald zur Schaufel, auf der Suche nach archäologisch interessanten Stücken aus längst vergangenen Zeiten. Auch der Apotheker Ludwig Leiner war dabei, wenngleich sein Interesse eher den Pflanzen und Schmetterlingen der Region galt.
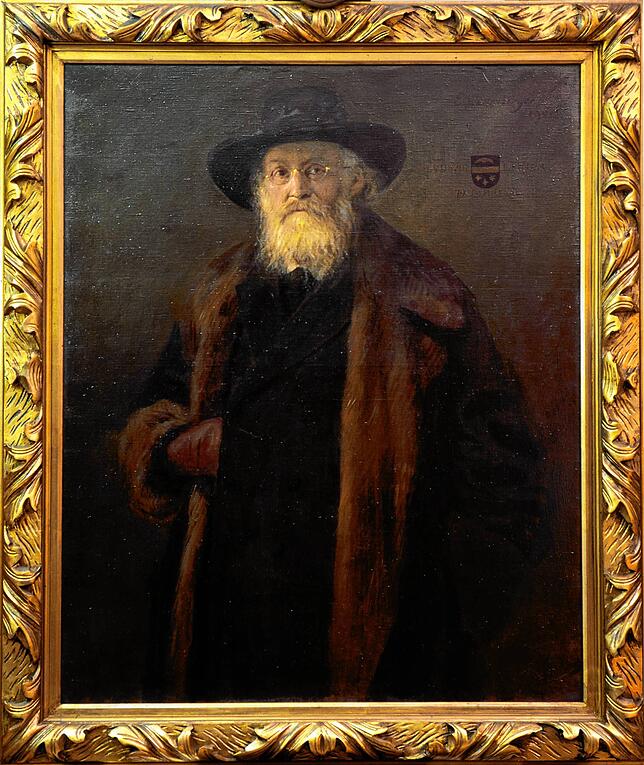
Eher ungewöhnlich ist, wie in Konstanz die Industrialisierung und damit auch der erste Tourismus das Entstehen eines Museums beförderte. Mit der Eisenbahnanbindung begann die Stadt, sich für Touristen zu öffnen, und schon damals waren es auch die vielen historischen Bezüge in dieser Stadt, die viele Besucher aus der Ferne an den See lockte.
Warnung vor dem Ausverkauf
Genau hier setzte der Apotheker Ludwig Leiner an: Wenn die Konstanzer nicht aufpassen, so lautete seine Warnung, dann werden all die schönen Fundstücke aus unserer Heimat nach und nach an Auswärtige verkauft und auf Nimmerwiedersehen fort geschleppt! Nur ein Museum könne dem Abhilfe schaffen, das leerstehende Zunfthaus „Zum Rosgarten“ biete sich doch an.
Dass die Stadt dem Apotheker nicht nur Gehör schenkte, sondern ihm auch nach und nach einen Ankaufsetat einräumte, zeigt einerseits, wie selbstverständlich Museumsarbeit bereits als öffentliche Aufgabe galt. Andererseits lässt es sich als Vertrauensbeweis verstehen für einen Sammler, der mit penibelsten Abrechnungen täglich seine buchhalterische Seriosität unterstrich.

Dieser Mann war offenbar ein Glücksfall für seine Stadt. Ablesen lässt sich das an Einzelvitrinen, die wie Inseln beiläufig in die Dauerausstellung gestreut wurden. Neben historisch reizvollen Gegenständen des täglichen Lebens und Glaubens – wie etwa Weihwasserfläschchen und Reliquienbehältnisse für den Hausgebrauch – finden sich dort auch manche von Leiners sage und schreibe 20.000 gesammelten Pflanzen. Dass darunter auch solche auftauchen, die heute gar nicht mehr in der Bodenseeregion zu finden sind, zeigt, wie sehr sich die heimische Flora seither gewandelt hat.
„Leiners Erben“
Die Exponate aus der Gründungszeit des Museums stellen den erkenntnisreichsten Part dieser Schau dar, die im Hauptausstellungsraum ganz oben für sich in Anspruch nimmt, auch die gesamte 150-jährige Geschichte zu reflektieren. Allerdings wird dieser Anspruch in der lesenswerten Begleitpublikation „Leiners Erben“ (Südverlag) überzeugender eingelöst als in der Ausstellung selbst. Das gilt insbesondere für die Auseinandersetzung mit Leiners Enkel Bruno, der als dritter Museumsdirektor das Haus durchaus geschickt durch die NS-Zeit brachte.
Nachkommen der Familie Leiner, sagt Engelsing, hätten sich über die Darstellung ihres Ahnen in diesem Band nicht erfreut gezeigt: Zur Wahrheit gehört, dass Leiner auf das Wohlwollen der Führung bedacht war (wer war das nicht?) in einem Fall einen unterwürfigen Brief an Görings Ehefrau Emmy schrieb und gelegentlich mit antisemitisch gefärbten Äußerungen in Erscheinung trat.
Zugleich aber war es ihm offenkundig gelungen, sein Museum von politischer Vereinnahmung weitgehend freizuhalten. Auch spricht für ihn, dass er nur ein Jahr nach Kriegsende zuvor als „entartet“ verschmähte Kunst zeigte – ein Unterfangen, mit dem sich zu dieser Zeit noch kaum öffentliche Anerkennung gewinnen ließ.
Im Unterschied zum Buch streift die Ausstellung diese politischen Hintergründe nur am Rande, ihre Exponate sind teils bedeutsam, teils skurril und manchmal beides zusammen. Dazu gehört der nur vermeintliche Thron von König Sigismund während des Konstanzer Konzils ebenso wie die tatsächlichen Fundstücke eiszeitlicher Kunst bei Schaffhausen. Letztere standen unter Fälschungsverdacht, weil der Sohn eines Mitarbeiters zwei Tiere hineingeritzt hatte, die in der Eiszeit so nie zusammen gesichtet worden wären.
Auch solche Eingriffe konnten passieren im 19. Jahrhundert: in einer Zeit, als Museumsarbeit noch dem Enthusiasmus ganz gewöhnlicher Bürger entsprang.
„Schätze des Südens – Kunst aus 1000 Jahren“: bis 11. April 2021 im Rosgartenmuseum. Öffnungszeiten: Di.-Fr. 10-18 Uhr, Sa.-So. 10-17 Uhr. „Leiners Erben“ ist im Südverlag erschienen und kostet 24,90 Euro. Weitere Informationen: rosgartenmuseum.de