Die Angst vor der Einsamkeit geht um: Psychologen warnen vor den psychischen Kollateralschäden des Corona-Lockdowns, Politiker fordern einen Bundesbeauftragten gegen Einsamkeit, in Großbritannien kümmert sich um diese Aufgabe schon seit zwei Jahren ein ganzes Ministerium. Wie kann das sein im Zeitalter der „sozialen Netzwerke“? Haben uns nicht die Vordenker der Digitalisierung versprochen, „die Menschen zusammenzubringen“? Sollten uns nicht technische Errungenschaften wie das Smartphone ein für allemal von dem Gefühl der Abgeschnittenheit und Isolation befreien?
Diana Kinnert ist Unternehmerin, Publizistin und engagiertes Mitglied der CDU. In letzterer Funktion hatte sie den Auftrag, ein Konzept für attraktivere Parteiarbeitsstrukturen zu entwickeln. Mehr Flexibilität, neue Digitalformate, weniger analoge Stammtische. Noch während sie an dem Papier arbeitete, kamen ihr Zweifel. So zeitgemäß das alles war: Es wirkte wie das Abbild einer von Vereinzelung geprägten Gesellschaft.

Tatsächlich ist Einsamkeit nämlich entgegen der Klischeevorstellung von allein gelassenen Senioren in Pflegeheimen vor allem ein Problem der jungen Generation. Telefonseelsorger berichten davon, dass inzwischen vor allem 30 bis 45-Jährige ihren Rat suchen. Eine Studie der Bochumer Ruhr-Universität bestätigt diese Erfahrung. Ausgerechnet jene also, die den Verheißungen von Facebook und Twitter in besonderem Maß vertraut haben, finden sich an der Spitze der Einsamkeitsstatistik wieder.
Was also sind die Gründe? Kinnert nimmt uns mit auf eine Exkursion durch digitale Lebenswirklichkeiten, umstrukturierte Innenstädte und einen grundlegend veränderten Arbeitsmarkt. Und je tiefer wir mit ihr ins Dickicht vordringen, desto deutlicher wird uns bewusst: Einsamkeit zu bekämpfen, das ist nicht mit ein paar Begegnungsräumen und Kontaktadressen getan. Es handelt sich um eine Aufgabe für Generationen.
Qual der Wahl
Da wäre zum Beispiel die Zumutung der Freiheit. Angesichts einer ständig zunehmenden Vielfalt an Möglichkeiten, unser Leben individuell zu gestalten, hat sich der Luxus längst in sein Gegenteil verkehrt. Psychologische Studien zeigen, dass der Mensch bei einer Auswahl von bis zu zehn Alternativen zum Treffen einer autonomen Entscheidung befähigt ist. Sieht er sich hingegen am Supermarktregal mit 50 verschiedenen Joghurtsorgen konfrontiert, schlägt Freiheit in Stress um: Statt sich wenigstens eines der angebotenen Produkte auszuwählen, verlässt der Kunde mit leeren Händen den Markt.
Was für materielle Produkte gilt, trifft auch auf Menschen zu. Dating-Plattformen wie Tinder überschütten ihre Nutzer mit endlosen Serien von Gesichtern und Profilen. Was anfangs noch wie ein Schlaraffenland der unbegrenzten Möglichkeiten anmutet, führt zielsicher in Überforderung und damit zu Rückzug, Abschottung.
Nicht allein das Konsumangebot drängt uns dazu, langfristige Bindungen als Last zu begreifen. Auch auf dem Arbeitsmarkt lösen Flexibilität und Mobilität alte Tugenden wie Stabilität und Kontinuität ab. Jederzeit bereit sein, sich in neue Aufgabengebiete einzufinden, gerne auch den Wohnort zu wechseln: Das zählt bereits seit Jahren mehr als etwa ein ausgeprägtes Bewusstsein für Treue, Beharrlichkeit und Verantwortung.
Quartiere für Uniformierte
Steigende Flexibilität geht keineswegs mit zunehmender Toleranz einher. Im Gegenteil: Die Übergänge sollen so reibungslos wie möglich funktionieren, Widerspruch, Unübersichtlichkeit und offene Fragen sind dabei nurmehr lästige Hindernisse. Deshalb mutieren von kultureller Vielfalt geprägte Stadtbezirke nach und nach zu homogenen Einheiten. Was einst als „Künstlerviertel“ pulsierendes Leben versprach, ist bloß noch ein Synonym für Gentrifizierung. Längst wandeln in den so bezeichneten Quartieren nur noch „Uniformierte, die es sich leisten können, hier zu leben, und die es sich nicht mehr leisten wollen, das Andere zu ertragen“.
Scharfsichtig stellt Kinnert die psychischen Konsequenzen dieser Entwicklung heraus: Wie unsere Städte, so haben wir auch unsere Emotionen gentrifiziert, der Sanierung des Äußeren folgte eine Sanierung des Inneren. Das Andere, Abweichende gilt plötzlich als schmutzig, ansteckend, gefährlich, eine „tiefe Angst vor Dissens“ macht sich breit. In einer aalglatten, durchgestylten Realität treten Rückzug und Tugendwahn anstelle von Begegnung und Diskurs.
Noch immer verstehen es die Profiteure dieser Entwicklung, uns das Alles mit hohlen Begriffen wie „Informationszeitalter“ zu verkaufen. Die Wahrheit ist, dass wahre Informiertheit selten so schwer zu haben war wie im Zeitalter der Einsamkeit. Und es ist zu leicht, die Ursache dafür allein bei den Fakenews-Strategen des Rechtspopulismus auszumachen. Das Problem liegt tiefer. Donald Trumps Erfolgsrezept beispielsweise, diagnostiziert Kinnert, habe entgegen der verbreiteten Annahme gerade nicht im Aus- und Gegeneinander bestanden. Vielmehr einten seine widersinnigen Weltthesen „gefühlte Verlierer der Moderne zu einem einzigen sozialen Aufstand gegen die Drehzahl der Welt“.
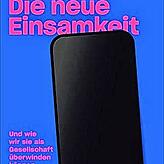
Es ist eine Welt, in der jedes fünfte Kind nicht mehr danach strebt, Lokführer oder Krankenpfleger zu werden, sondern nur noch „reich sein“ will. So lautet das traurige Ergebnis einer Umfrage in Großbritannien – jenem Land, das jetzt mit einem Einsamkeitsministerium versucht, zu retten, was noch zu retten ist.
Wie kommen wir da raus? Antworten auf diese drängende Frage sind in Kinnerts ansonsten überaus kenntnisreicher, lesenswerter Analyse etwas unterrepräsentiert. Ohne den aktiven Widerstand jedes Einzelnen wird es jedenfalls nicht gehen. Mit Mut zur „Nichtlinearität, Nichtglätte und Ineffizienz“ könnte ein Anfang gelingen. Notwendig wäre es schon allein aus gesundheitlichen Gründen. Einsamkeit, ergab eine Studie der Birgham Young Universität im US-Bundesstaat Utah, schädigt uns in etwa so stark wie der Konsum von 15 Zigaretten am Tag.







