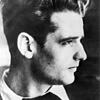Das bekannteste Attentat auf den Reichskanzler und „Führer“ Adolf Hitler wurde vor 75 Jahren in dessen Hauptquartier „Wolfsschanze“ in Ostpreußen von Offizieren der Wehrmacht ausgeführt. Niedergeschlagen wurde der Staatsstreich vom 20. Juli 1944 in der Reichshauptstadt Berlin. Die Verschwörer bezahlten mit ihrem Leben.
Der bekannteste der Attentäter stammte aus dem Süden des Landes: Der 1907 in Jettingen bei Günzburg geborene Claus Schenk Graf von Stauffenberg war jüngster Sohn des damaligen Oberhofmarschalls des letzten württembergischen Königs, Wilhelm II., und der Hofdame der Königin Charlotte, Gräfin Caroline von Üxküll-Gyllenband. Mutter Caroline, deren deutsch-baltische Familie im Schwabenland heimisch geworden war, genoss das besondere Vertrauen der Königin. Über die deutsch-baltischen Verbindungen wurden damals in Württemberg zahlreiche Ehen vermittelt, so auch bei den Grafen Ferdinand und Eberhard von Zeppelin, deren Frauen mit den Üxkülls verwandt waren.

Stauffenbergs Vater Alfred, ein wortkarger, handwerklich begabter Nachkomme eines alten Adelsgeschlechts in Diensten der Hohenzollern, hatte eine württembergische Militärlaufbahn absolviert und war 1897 in den Hofdienst gewechselt. Dort gewann er das Vertrauen des bürgernahen Königs. Der württembergische Wilhelm spazierte täglich unbewacht und in Zivilkleidung mit seinen Hunden durch den Stuttgarter Schlosspark, freundlich die Bürger grüßend.
Wohnung im Stuttgarter Schloss
Die Stauffenbergs lebten mit ihren Söhnen Berthold, Alexander und Claus in einer Dienstwohnung im Stuttgarter Alten Schloss, ihre dienstfreie Zeit verbrachte die Familie im eigenen Landsitz auf Schloss Lautlingen bei Albstadt. Zeitweise hatten die Eltern während der „Sommerfrische“ des Herrscherpaares auch in der Sommerresidenz in Schloss Friedrichshafen präsent zu sein. Während der Wochen in Schloss Lautlingen unternahm die Familie ausgedehnte Ausflüge zwischen der Alb und dem Bodensee.
Nach dem Ende der Monarchie 1918 setzte Sohn Claus die Militärtradition der Familie fort: Nach dem Abitur trat er 1927 in das 17. Bayerische Reiter-Regiment in Bamberg ein, absolvierte die Infanterieschule in Dresden und die Kavallerieschule in Hannover. Stauffenberg war ein untypischer Offiziersanwärter: Er hielt sich von Trinkgelagen, Tanzvergnügungen und Casinos fern und bot nur wenigen Kameraden das vertraute Du an.
Vortrag auf dem Hohentwiel
Als die Abschlussklasse der jungen Berufsoffiziere 1936 eine Bodensee-Reise unternahm, hielt Stauffenberg seinen Lehrgangskameraden auf der Festungsruine des Hohentwiel über Singen einen tiefschürfenden Vortrag. Dessen Leitgedanke verweist auf das damalige Weltbild des 29-jährigen Adligen – und auch schon auf die Zustimmung des späteren Offiziers zu Hitlers ehrgeiziger Expansionspolitik: Er erinnerte die Kameraden daran, dass sie auf dem Hohentwiel in der Mitte des alten Hohen-staufer-Reiches stünden. Ein mächtiges „Universalreich“, in dem die Deutschen „einst die höchste Erfüllung“ gefunden hätten: „Höchste kulturelle Gestaltung“ sei für den Deutschen „stets verbunden (gewesen) mit universeller Wirkung: das Heilige Reich, der Humanismus, die Klassik“.

Auch andere Einflüsse schwingen in diesen Worten mit: 1923 hatte der damals 16-jährige Claus Stauffenberg den lebensreformerisch und esoterisch-kosmisch orientierten Lyriker Stefan George kennengelernt, dessen Vision von einem Wiedererstarken des alten Reichs unter der Leitung edler „Führer“ den jungen Grafen beeindruckte.
Die Nationalsozialisten reklamierten George später für sich, doch der entzog sich, auch starb er bereits 1933. In späteren Lebensjahren hatte George einen Kreis teils hochbegabter Jünger um sich geschart. Zu einigen Eleven unterhielt der Dichter auch Liebesbeziehungen, die Stauffenberg-Brüder Berthold und Claus gehörten nicht dazu.
Nicht der einzige Anschlag gegen Hitler
Mehrere Male hatte George die Sommerwochen in Wasserburg am Bodensee verbracht. Die Brüder Stauffenberg kamen dann immer angereist, um dem Mentor von ihren Fortschritten zu berichten. Von Wasserburg aus war George seit 1931 nach Minusio im Schweizer Kanton Tessin weitergezogen, um im südlichen Klima zu überwintern. Dort starb er im Dezember 1933.
Stauffenbergs weitere Karriere als Berufsoffizier in der Wehrmacht Adolf Hitlers ist in der großen Biografie von Peter Hoffmann und in der jüngst erschienenen, umstrittenen Studie von Thomas Karlauf eindrücklich beschrieben worden. In Stauffenbergs Lebenszeugnissen fänden sich, so Karlauf, bis 1942 keine Belege, dass er einen Staatsstreich gegen den Reichskanzler Adolf Hitler in Erwägung gezogen hätte.
Nach seiner Abkehr aber wurde er schnell zum Kopf jener Widerstandsbewegung, die im Tyrannenmord den einzigen Ausweg aus der totalen Katastrophe sah – übrigens fünf Jahre nach dem Schreinergesellen Johann Georg Elser, der Hitler bereits 1939 in München in die Luft zu sprengen versucht hatte.
„Die Vorsehung erhielt uns unseren Führer“
Der späte Sinneswandel schmälert die Tat Stauffenbergs und seiner Mitverschwörer nicht, wie neuerdings behauptet wird. Vielmehr illustriert der waghalsige Staatsstreich, wie grundlegend der Bruch des 1944 zum „Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres“ und zum Oberst beförderten Grafen mit seinem obersten Befehlshaber war und wie entschieden er dann handelte. Während die große Mehrheit der Generalität ihrem „Führer“ bedingungslos in den Untergang folgte und dabei Hunderttausende mitnahm, wagten die Männer des 20. Juli – wenn auch spät – die befreiende Tat.
Zur historischen Wahrheit des 20. Juli gehört, dass der Versuch, den Verbrecher an der Staatsspitze zu stürzen, von der Bevölkerungsmehrheit keineswegs begrüßt wurde. Die in Konstanz erscheinende „Bodensee-Rundschau“ titelte am 21. Juli nach vorgegebener Sprachregelung: „Die Vorsehung erhielt uns unseren Führer.“
Hitlers Rache
In Leitartikeln lokaler Redakteure frischte die Zeitung danach die „Dolchstoß“-Legende vom Ende des Ersten Weltkriegs auf, wonach wenige Verräter der unbesiegten Front in den Rücken gefallen seien. Diese Lesart stieß auf breite Zustimmung. Der 1933 abgesetzte sozialdemokratische Konstanzer Bürgermeister Fritz Arnold, 1944 Wehrmachtsoffizier im besetzten Amsterdam, etwa schrieb nach Hause: „Ausgerechnet jetzt, wo alles drauf ankommt, das Schiff unseres Staates durch den Sturm zu leiten, wollen diese Verbrecher den Kapitän austauschen.“
Hitler rächte sich fürchterlich: In Schauprozessen des Volksgerichtshofs wurden Dutzende Mitverschwörer abgeurteilt und in Berlin-Plötzensee an Klaviersaiten aufgehängt. Auch Berthold von Stauffenberg wurde dort ermordet. Der dritte, am Aufstand nicht beteiligte Bruder, Alexander, überlebte mit Familienmitgliedern die „Sippenhaft“ und das Kriegsende.
Erholung am Bodensee
Erschöpft von der KZ-Haft suchte er nach dem Krieg einige Jahre lang Erholung am Bodensee: Bei dem alten Freund aus dem George-Kreis, dem Germanisten Rudolf Fahrner und seiner Lebensgefährtin Emma Wolters-Thiersch, fand Alexander Graf Stauffenberg ein Refugium. Später, als Professor für Alte Geschichte in München, engagierte er sich gegen die Notstandsgesetzgebung und gegen eine atomare Aufrüstung der Bundesrepublik.
Tobias Engelsing ist Historiker und Direktor der Städtischen Museen Konstanz
Warum das Attentat auf Hitler scheiterte
Am 20. Juli 1944 entging Adolf Hitler nur knapp dem Tod. Man muss sagen: Der Diktator hatte einfach Glück und die Attentäter nicht das, was man Fortune nennt. Hier einige Gründe für das Scheitern:
- Behinderung: Claus Schenk Graf von Stauffenberg wurde als Offizier in Tunesien im April 1943 schwer verletzt. Zwei Finger der linken Hand mussten amputiert werden. Dies behinderte ihn 15 Monate später beim Scharfmachen des Sprengstoffs im Hauptquartier Wolfsschanze am 20. Juli 1944. Hinzu kam, dass er dabei gestört wurde. Er wurde zur Frontlage-Besprechung mit Hitler gerufen und hatte nicht mehr die Zeit, das zweite Sprengstoff-Paket in seine Aktentasche zu packen. Das reduzierte die Wirkung der Bombe erheblich. Sie wäre sonst für alle im Raum tödlich gewesen.
- Pech: Am 20. Juli 1944 war es sehr heiß. Daher wurde die Besprechung mit Hitler nicht wie üblich in einem Bunkerraum abgehalten, sondern in einer Baracke, deren Fenster man öffnen konnte. Die Detonation der Bombe war zwar heftig und tötete vier Menschen. Doch in dem Leichtbau konnte die Druckwelle nach draußen entweichen. Im Bunker wären vermutlich alle Anwesenden getötet worden. Zudem stand die Tasche bei der Explosion neben einem massiven Tischblock, der Hitler quasi schützte.
- Überlastung: Ein Webfehler der Attentatsplanung war die Doppelrolle von Stauffenbergs. Er musste in Ostpreußen zuerst die Bombe platzieren, dem Alarm im Sperrkreis der Wolfsschanze entkommen und dann nach Berlin fliegen, um dort den Staatsstreich zu leiten.
- Chaos: Der Staatsstreich-Plan konnte organisatorisch kaum gelingen, zumal Stauffenberg noch im Flugzeug saß, als die Meldung vom Überleben Hitlers von der Wolfsschanze in Berlin eintraf. Nur mit der Notlüge, er habe Hitler tot gesehen, konnte Stauffenberg im Bendlerblock Mitverschwörer und distanzierte Befehlshaber davon überzeugen, den Staatsstreich unter dem Namen „Operation Walküre“ zu beginnen und (zögerlich) mitzutragen. Angesichts der unklaren Lage blieben die meisten Befehlshaber in den Wehrkreisen des Reichs untätig, und es kam nicht zur geplanten Entmachtung der örtlichen Nazi-Größen durch das Militär. Als sich Hitler abends im Rundfunk meldete, brach der Umsturz in sich zusammen.