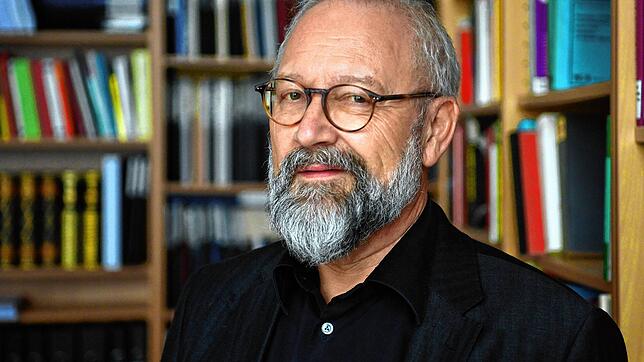Herr Münkler, mehr als 100 Tage währt der Krieg gegen die Ukraine nun schon. Russlands Präsident Wladimir Putin setzt auf die Macht der langsamen, aber brutalen Zerstörung. Wird er als Sieger aus dieser Schlacht hervorgehen?
Siegen und verlieren – das sind schwierige Begriffe in diesem Krieg. Denn es gibt verschiedene Ebenen: die geopolitische, die politische, die wirtschaftliche und die strategische Ebene des Truppenvormarsches. Putins Strategie, mit schnellen Vorstößen auf Kiew, Charkiw und andere Städte sowie mit der Enthauptung der Regierung Herr des gesamten Raumes zu werden, ist gescheitert. Er muss also den langsamen und mühsamen Weg gehen.
Allerdings spricht inzwischen einiges dafür, dass die Ukraine dies auf Dauer nicht durchhalten kann. Ich glaube, dass Präsident Wolodymyr Selenskyjs Erklärungen, im Sommer werde die große ukrainische Gegenoffensive kommen, eher ein Pfeifen im Walde sind. Selbst wenn die Ukraine westliche Waffen bekommt, ist unklar, ob sie die kompetent einsetzen kann.
Was heißt das für den weiteren Verlauf des Krieges?
Ich könnte mir vorstellen, dass es auf einen Waffenstillstand hinausläuft, der dann Schritt für Schritt in eine Befriedung des Konflikts übergeht – ob man wirklich von Friedensvertrag wird sprechen können, muss man sehen. Die Ukraine würde wohl große Teile des Donbass verlieren, genauso wie die Teile der Küste zum Schwarzen Meer.
Das ist ein bitteres Ergebnis, zumal die Ukraine das sehr teuer bezahlt hätte. Aber ist das für Putin ein Sieg? Im Prinzip säße er auf einem Trümmerhaufen, den er erobert hat. Er hat alles kaputt geschossen und müsste sich dann selbst um den Wiederaufbau kümmern.

Das Ergebnis könnte ein ewig schwelender Konflikt sein – weder die Ukraine noch Russland dürften sich mit diesem Status zufriedengeben.
Das Ergebnis darf nicht sein, dass immer wieder Kampfhandlungen aufflackern. Ziel muss sein, dass die Ukraine kein Interesse daran hat, zu einer revisionistischen Macht zu werden, dass sie also nicht darüber nachdenkt, wie sie das, was Putin ihr abgenommen hat, zurückholt. Das sind die klassischen Probleme von Friedensordnungen.
Wie lassen die sich lösen?
Man könnte der Ukraine den Willen zum Revisionskrieg abkaufen, indem man ihr von Seiten der EU Wohlstand verspricht. Eine zweite Möglichkeit, die freilich bei den Russen läge, wäre Appeasement, also dass man den Wünschen der Ukraine entgegenkommt – doch das ist wenig wahrscheinlich. Putin wird die Gebiete, die er erobert hat, nicht zurückgeben.
Die dritte Möglichkeit wäre klassisches Containment: Beide Seiten stehen sich hochgradig bewaffnet gegenüber. Das dürfte es sein, worauf man sich einstellen muss, wenn dieser Krieg zu Ende ist. Das wird für beide Seiten teuer werden.
Könnte ein EU-Beitritt ein Versprechen an die Ukraine sein?
Dem müssen alle EU-Mitglieder zustimmen. Frankreich sagt explizit nein. Die Kopenhagener Kriterien müssen erfüllt sein – das wird für die Ukraine noch ein langer und schwieriger Weg. Die Europäer werden sich auch sehr gut überlegen, wie viele potenzielle Veto-Spieler sie haben wollen.
Die Probleme mit Polen sind zuletzt zwar in den Hintergrund getreten, aber die mit Ungarn sind nach wie vor da. Hinzu kommt, dass aus dem Westbalkan bereits einige Kandidaten in der Warteschlange stehen.
Eine Möglichkeit wäre, Länder in eine Ebene unterhalb der Vollmitgliedschaft aufzunehmen. Damit könnte man der Ukraine Möglichkeiten geben, wieder in eine einigermaßen funktionierende Ökonomie aufzubauen.
Sollte dieses Szenario Wirklichkeit werden, mag Putin Geländegewinne für sich in Anspruch nehmen, aber auf politischer Ebene hat er enorme Verluste erlitten. Er ist isoliert. Wie könnte ein Platz Russlands in der Weltgemeinschaft überhaupt noch aussehen?
Russland besitzt nach wie vor mehr als 50 Prozent aller weltweiten Nuklearsprengköpfe und die entsprechenden Trägersysteme – es wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn man die Russen nicht zu Vereinbarungen und Gesprächen bewegt.
Das Hauptproblem ist: Wie kann man das Vertrauen in Vereinbarungen mit Moskau wieder herstellen, nachdem es am 24. Februar komplett zerstört wurde? Ich kann das nicht sagen. Womöglich erst nach Putin. Diesen Weg werden die Berufsdiplomaten zu beschreiten haben.

Und auf wirtschaftlicher Ebene?
Die Finanzkreisläufe Russlands und des Westens sind inzwischen weitgehend entkoppelt. Wir im Westen werden auf mindestens ein Jahrzehnt hinaus den Höhepunkt unseres Wohlstandes überschritten haben. Sanktionen werden sich mehr und mehr bemerkbar machen, wir kaufen auch nicht mehr so viel Öl und Gas wie vorher. Das kann Putin aber offenbar verschmerzen, weil er durch den höheren Öl- und Gaspreis weiterhin gut verdient. Das zeigt, dass die westliche Vorstellung, man könne den Gebrauch militärischer Gewalt durch wirtschaftliche Macht konterkarieren, so ohne weiteres nicht aufgeht.
Wirtschaftliche Sanktionen haben eine ungeheure Streuung, die auch die nicht besonders wohlhabende russische Bevölkerung trifft. Doch die macht Putin keinen Stress, weil sie verzichts- und leidensfähig ist. Technologie, wie etwa Chips, könnte Russland von den Chinesen bekommen. Das heißt aber, die Russen werden so etwas wie der Juniorpartner Chinas werden. Am Ende dürfte sich also Xi Jinping die Hände reiben, weil er den Takt des Geschehens in einer Koalition der autokratischen Staaten vorgibt.
Für Putin dürfte das keine schöne Vorstellung sein...
Ja, auf der geopolitischen Ebene hat Putin keinen Stich gemacht. Fast könnte man sagen, er hat das Spiel verloren. Denn als Juniorpartner Chinas herauszukommen, das kann nicht sein Interesse gewesen sein. Aber es kann auch nicht in unserem Interesse sein, Putin in die Arme von Xi Jinping zu treiben.
China ist ein gutes Stichwort. Gerade wurde offengelegt, wie massiv die Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren sind. Glauben Sie, dass Russlands Krieg ein Anstoß war, auch andere neu zu bewerten?
Schauen wir kurz zurück auf das, was im Sommer auf dem Flughafen von Kabul geschehen ist. Möglicherweise war das ein Vorgeschmack für die tiefen Veränderungen im Hinblick auf unsere eigenen politischen Vorstellungen. Wir haben, wenn ich das mal so dramatisch sagen darf, die afghanischen Frauen den Taliban ausgeliefert.
Das heißt, dass wir künftig den Geltungsanspruch von Menschenrechten tendenziell auf das eigene Gebiet beschränken werden. Das wird sich auch im Umgang mit China zeigen. Es kommt niemand auf die Idee zu sagen, dass wir Wirtschaftssanktionen brauchen. Sollten sich westliche Firmen tatsächlich aus China zurückziehen, dann tun sie das, um für westliche Kunden, die auf Menschenrechtsfragen schauen, attraktiver zu sein.
Nicht die Politik, sondern der Markt wird also die Regeln aufstellen. Erwachsen wird daraus eine Weltordnung, die aus fünf großen Mächten besteht. Die Europäer gehören dazu, wenn sie sich von einem Regel-Bewacher in einen handlungsfähigen Akteur verwandeln. Ich würde nicht drauf wetten, dass sie das schaffen…
Selbst beim Krieg vor der eigenen Haustür sind die Europäer massiv von den Amerikanern abhängig, lassen dem „Weltpolizisten“ gerne den Vortritt.
Ich gebe den Europäern eine Fifty-Fifty-Chance. Die Ereignisse von Kabul waren eine Peinlichkeit, aber das, was in der Ukraine geschieht, ist ein Schock. Eigentlich hatte sich Amerika ja aus der europäischen Sicherheitspolitik verabschiedet, um sich eher auf Asien zu konzentriert. Nun müssen sie in der Ukraine den Takt vorgeben. Die Europäer schauen, verstecken sich hinter Formulierungen, dass es keine Alleingänge geben dürfe.
Die Deutschen waren Moral-Weltmeister. Aktuell gelten sie vielen als das schwächste Glied in der Kette. Wie verändert uns diese Wahrnehmung?
Die Bigotterie ist aufgeflogen. Genauso wie die Erzählung, dass wir keine Waffen in Kriegsgebiete liefern. Das war am Anfang die Verteidigungslinie gegenüber den Erwartungen der Ukraine. Dann kam heraus, dass wir ständig Waffen in Krisengebiete liefern: an das Nato-Mitglied Türkei, an Ägypten… Moral-Weltmeister waren wir immer nur auf der Grundlage, dass wir nie so genau hingeschaut haben.
Das Kommunizieren des Moralischen war auch eine Form deutscher Interessenpolitik: Man hat sich mit vielen NGOs verbunden und seinen Einfluss vergrößert. Aber die politische Bewirtschaftung von moralischen Erwartungen hat den unangenehmen Effekt, dass, wenn es ernst wird, man unter erhöhtem Druck steht. Kein ukrainischer Botschafter in einem anderen europäischen Land konnte so viel Druck machen wie Andrij Melnyk, weil er die Deutschen an ihrem Moralbeutel hatte.
Wie sehen Sie die Rolle von Kanzler Scholz? Er ist mit einem großen Vertrauensvorschuss ins Amt gestartet. Inzwischen hat er den Ruf als Zauderer.
In mancher Hinsicht setzt er den Führungsstil von Angela Merkel fort: relativ lange beobachten, ausgleichen, moderieren. Andererseits fehlt ihm etwas, was Merkel eben auch konnte: In bestimmten Situationen auch von vorn zu führen. In Scholz‘ Zeitenwende-Rede hatte man das Gefühl, er sei ein gelehriger Schüler. Jetzt zeigt sich aber, dass es in einer Dreierkoalition schwieriger ist als in einer Zweierkoalition. Hinzu kommt, dass die Folgebereitschaft der Sozialdemokratie ihm gegenüber – nachdem er sie durch den Sieg der Bundestagswahl gerettet und geheilt hat – zwar groß ist, aber nicht bedingungslos.
Aber ich glaube, es fehlt ihm auch die Bereitschaft und Fähigkeit, riskante Entscheidungen zu treffen. Viele Wähler schätzen zwar diese Risikovermeidung. Aber es gibt eben Zeitumstände, die dazu führen, dass man damit nicht durchkommt. Es wird sich über kurz oder lang eine Krise für die Dreierkoalition daraus entwickeln.
Weil Olaf Scholz zum Getriebenen wird?
Wenn nicht Putins Panzer über den Koalitionsvertrag gerollt wären, hätte das alles gut funktionieren können. Und dann hätte auch die spezifische Führungsfähigkeit von Olaf Scholz gereicht, um diesen Prozess zu moderieren.
Das entscheidende Problem ist eben die Veränderung der Zeitumstände, die es erforderlich machen, dass jemand auf der Grundlage von eigenem Charisma und dem Charisma des Amtes Entscheidungen trifft und die auch durchsetzt. Das Vertrauen in die Führungsfähigkeit von Olaf Scholz zerbröselt.