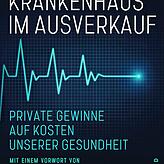Herr Strohschneider, sie kritisieren ein Krankenhaus-Monopoly in der deutschen Kliniklandschaft und die fortschreitende Privatisierung des Klinik- und Gesundheitsmarktes. Warum?
Mitte der 80er-Jahre hat der Gesetzgeber erlaubt, dass Kliniken Gewinne machen dürfen. Seitdem sind in Deutschland private Klinik-Konzerne entstanden, die mittlerweile fast 40 Prozent aller Krankenhäuser betreiben, Tendenz weiter steigend. Diese Konzerne haben das Gemeinwohl und das Wohl der Patienten nur nebenbei im Sinn. In erster Linie bedienen sie die Interessen ihrer Investoren und Shareholder.
Das heißt, im Vordergrund stehen gewinnbringende Behandlungen?
Ganz klar ja. Kliniken privater Klinikkonzerne konzentrieren sich vor allem auf gewinnbringende Sparten und bieten die Eingriffe und Operationen an, die möglichst hohe Einnahmen und damit Profite einbringen. Das kann man mit einem Gemischtwarenladen vergleichen, der die Produkte aussortiert hat, mit denen man keinen oder kaum Gewinn macht. Bei den Produkten, die gut laufen, schaut man, wie man den Erlös maximieren kann.

Was heißt das für die Krankenhäuser in kommunaler oder öffentlicher Trägerschaft?
Die müssen auch jene Patienten behandeln, die privatwirtschaftliche geführte Kliniken lieber meiden oder ablehnen. Ein Landrat oder die politisch Verantwortlichen müssen garantieren, dass alle medizinischen Fachbereiche, die zur kompletten Versorgung der Bevölkerung unabdingbar notwendig sind, vorgehalten werden. Unabhängig davon, ob sie defizitär sind oder nicht.
Haben Sie ein Beispiel?
Zu den Verlierern gehört beispielsweise die Kindermedizin. In Baden-Württemberg wurden in den letzten 20 Jahren ganze Kinderkliniken geschlossen und insgesamt ein Drittel der Betten abgebaut. Die Behandlung von Kindern ist viel personalintensiver im Vergleich zu der Erwachsenenmedizin. Die 2003 eingeführten Fallpauschalen, das sogenannte DRG-System (nach Diagnosis Related Groups, d. Red.), bildet diese Tatsache aber nicht annähernd gerecht ab. Dies hat zu einer chronischen Unterfinanzierung der Kinderkliniken geführt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass privatwirtschaftlich geführte Krankenhäuser im Vergleich zu anderen Klinikträgern deutlich weniger Kinderkliniken betreiben. Dafür überproportional häufig Orthopädien.
Wie kann man in Krankenhäusern denn überhaupt Gewinne erzielen?
Mit Operationen und Eingriffen, die sich zum einen im DRG-System mit Gewinn abrechnen lassen und die zum anderen gut planbar sind. Eine Hüft-OP etwa kann man meist ein halbes Jahr vorher terminieren, die stationäre Verweildauer eines Patienten ist gut kalkulierbar. Man weiß, dass der Patient anschließend von einer Reha-Einrichtung betreut wird. Bei 95 Prozent dieser Patienten gibt es keine Probleme. Deshalb ist der gesamte Bereich der Orthopädie für Kliniken lukrativ, dazu gehören künstliche Hüftgelenke, Knie-Implantate und die Wirbelsäulen-Operationen. Was sich auch sehr gut abrechnet, sind herzchirurgische Eingriffe und plastische Operationen.

Führt dieses Goldader-Phänomen zu einem Überangebot an diesen Leistungen?
Ja, genau. Vor allem kommt es zu medizinisch fragwürdigen oder sogar zu überflüssigen Eingriffen und außerdem zu unnötig hohen Kosten für das Gesundheitswesen. Diese Übertherapie macht unser Gesundheitssystem teuer. Am unteren Rand stehen dagegen die Verlierer, das sind meist ältere, mehrfach oder chronisch Erkrankte, die gewinnorientierte Klinikkonzerne möglichst nicht in ihren Kliniken haben wollen.
Auch eine Art Zwei-Klassen-Medizin?
Durchaus. Im Prinzip haben wir in Deutschland zwischen den Kliniken einen Wettbewerb um die lukrativsten Patienten. Das sollte es in einem Gesundheitssystem, das der Daseinsvorsorge dienen soll, nicht geben! Dann kommt hinzu: Die Bundesländer verstoßen elementar gegen die eigene Gesetzgebung. 1972 wurde das duale Krankenhausfinanzierungssystem beschlossenen, das vorsieht, Investitionskosten für Gebäude und technische Ausstattung über Steuern zu finanzieren und die Gesundheitsleistungen und Betriebskosten über die Kassen abzurechnen.
Und das System funktioniert nicht mehr?
Es ist am Boden. Experten sagen, dass die Kliniken von den Ländern nur noch maximal die Hälfte der notwendigen Finanzierung erhalten. Die Folge ist, dass Kliniken – wenn sie nicht riskieren wollen, den Anschluss zu verlieren – gezwungen sind, fantasievoll Einnahmen auf Kosten der Kassen und Versicherten zu generieren, um investieren zu können. Diese fehlenden Finanzmittel müssen dann aus den DRG-Erlösen herausgepresst werden. Die Folge: um mehr Erlöse zu erzielen, müssen mehr Fälle generiert werden.
Daraus resultieren dann etwa auch die teilweise überflüssigen Wirbelsäulen-Operationen?
Richtig. Zwischen 2007 und 2020 haben sich diese in Deutschland verdoppelt. Man fragt sich, ob eine Rückenschmerz-Epidemie das Land heimgesucht hat oder ob nicht die vergleichsweise gute finanzielle Vergütung eine Rolle spielt. Bei Herzkatheteruntersuchungen sind wir übrigens Weltmeister. Unsere französischen Nachbarn führen ein Drittel weniger solcher Eingriffe durch und leben genauso lang wie wir Deutschen.
Das heißt, wir werfen hier Geld zum Fenster hinaus. Ist es denn bei den Gewinnen der privaten Klinikkonzerne nicht genauso?
Ja, sicher. Die Rendite-Erwartungen der Konzerne liegen zwischen 10 und 15 Prozent. Das ist für mich der eigentliche Skandal: Dass man sich hier aus dem Topf der Sozialkassen bedient, wobei immer klar ist, dass der Zufluss nicht versiegen wird. Dieses System ist wie ein Selbstbedienungsladen.
Wird von den Klinikleitungen Druck auf die Ärzte ausgeübt, um hohe Einnahmen zu generieren?
Das kann ich als Arzt, der acht Jahre lang unter dem Dach eines privaten Konzerns gearbeitet hat, bestätigen. Einem Chefarzt wird klargemacht, dass er neben der medizinischen auch eine unternehmerische Verantwortung hat. Bei jeder monatlichen Leitungskonferenz mit der Geschäftsführung stehen wirtschaftliche Bilanzen klar im Vordergrund. Abteilungen werden miteinander verglichen und dadurch Druck aufgebaut, bis hin zur Androhung, Abteilungen zu schließen.
Inwieweit betrifft das das Wohl der Patienten?
Bei Patienten, die gleichzeitig an mehreren Erkrankungen leiden, wird zunächst die Haupterkrankung behandelt, weil nur diese im Fallpauschalen-System abgerechnet werden kann. Das wäre so, wie wenn Sie mit Ihrem Auto, das mehrere Mängel hat, in die Werkstatt fahren, und nur ein Schaden wird repariert. Nach sechs Wochen kommen Sie wieder und der nächste Defekt wird behoben. In der Realität würde man das nie so machen! Aber in der Klinikmedizin ist dieses „Reparieren in Etappen“ lukrativ, weil man jedes Mal einen neuen Fall hat und neue Rechnung stellen kann. Mit dieser Drehtürmedizin ist die Zahl der stationären Behandlungen in Deutschland in den letzten 20 Jahren um über fünf Millionen gestiegen.
Wird sich durch das geplante Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach etwas zum Besseren wenden?
Da habe ich große Zweifel und traue Lauterbach und seiner Kommission nicht über den Weg. Ich befürchte, dass es zu weiteren Klinikschließungen kommt und dass die Privatisierungswelle nicht aufgehalten wird. Das DRG-System, an dessen Einführung Lauterbach ja mitgearbeitet hat, wird keineswegs abgeschafft, sondern nur modifiziert.
Klinikschließungen – wie jetzt die in Radolfzell – will man gegenüber den Bürgern dadurch abfedern, dass man ihnen ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) ankündigt. Augenwischerei?
Allerdings. Es wird den Leuten weisgemacht, ein MVZ oder ein interdisziplinäres Zentrum habe die gleiche Qualität und erfülle dieselben Aufgaben wie ein Krankenhaus. Das ist bei weitem nicht so. Die MVZ sind nur bessere Arztpraxen, die am Wochenende teilweise geschlossen sind und keine Rundumversorgung anbieten werden. Eine sinnvolle Planung von MVZ-Strukturen – wie in Dänemark – würde zunächst Milliarden an Investitionen voraussetzen.

Aber die MVZ werden eine Rolle spielen?
Grundsätzlich brauchen wir sowohl eine ambulante wie eine stationäre Versorgung. Aber die Entscheidung darüber, an welchem Standort solche Strukturen vorgehalten werden und ob dafür sich doch manches kleine Krankenhaus besser eignet, darf sich nicht in erster Linie nach ökonomischen Kriterien richten. Übrigens sitzen zum Teil dieselben Investoren, die private Klinikkonzerne betreiben, schon in den Startlöchern für solche MVZ: Hier tut sich ein neues, gewinnversprechendes Feld auf, das gute Renditen verspricht. MVZ können Kliniken nicht ersetzen – das sieht übrigens auch die Bundesärztekammer so.
Buchtipp: Thomas Strohschneider: Krankenhaus im Ausverkauf. Private Gewinne auf Kosten unserer Gesundheit, Westend-Verlag, 238 Seiten, 18 Euro.