Die gestiegenen Energiekosten stimmen viele Hausbesitzer nachdenklich, vor allem wenn noch eine alte Gas- oder Ölheizung im Keller steht. Wärmepumpen werden von der Politik derweil mit Förderprogrammen als wichtiger Baustein der Ernergiewende gefeiert. Doch ist es wirklich so einfach?
Nein – sie eignen sie sich nicht für jedes Haus, sagt etwa Alfred Keller, Obermeister der Innung Sanitär, Heizung und Klima im Bodenseekreis. Auch stoßen Heizungsmonteure und Produzenten durch die rasant gestiegene Nachfrage an ihre Kapazitätsgrenzen.
Wer über einen Austausch der Heizungsanlage nachdenkt, sollte sich vorher gut informieren und auch längere Lieferzeiten und steigende Preise mit einplanen.
Wann lohnt sich der Einbau einer Wärmepumpe?
Wärmepumpen wurden im vergangenen Jahr in über 40 Prozent der Neubauten eingebaut. Doch sind sie auch für eine Bestandsimmobilie die beste Wahl? In 87 Prozent der rund 19 Millionen Wohngebäude in Deutschland sind die Heizungsanlagen teil- oder unsaniert und haben damit noch deutliches Potenzial in Bezug auf Klimaschutz und CO2-Reduzierung. Das steht in einem Bericht des Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH).
„Doch technisch lässt sich eine Wärmepumpe nicht in jedes Haus einbauen“, sagt Alfred Keller, der einen Heizungs- und Sanitärbetrieb in Lippertsreute bei Überlingen hat. In einer nicht isolierten Bestandsimmobilie ohne Flächenheizung – etwa einer Fußbodenheizung – seien andere Systeme unter Umständen sinnvoller.

Am effizientesten laufe eine Wärmepumpe, wenn die Vorlauftemperatur möglichst niedrig ist, so Keller. Dann braucht die Anlage weniger Energie, um das Gebäude auf eine bestimmte Temperatur zu heizen. Ideal ergänze sie sich mit Flächenheizungen, die nicht nur im Fußboden, sondern auch in Decken oder Wänden eingebaut werden könnten, oder Niedertemperaturheizkörpern.
Warum ist die Dämmung so wichtig?
Damit die Wärmepumpe effizient arbeiten kann, ist eine gute Dämmung des Gebäudes wichtig. „Ein Neubau hat in der Regel schon durch die gesetzlichen Vorgaben eine optimale Gebäudehülle“, sagt Tobias Bacher von der Energieagentur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, der für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg berät.
Bacher erklärt: Hat ein Altbau eine schlechte Dämmung und Heizkörper, wird eine höhere Vorlauftemperatur benötigt. Die Wärmepumpe arbeite dann weniger wirtschaftlich. Er empfiehlt, beim Thema Heizen zuerst zu schauen, was an der Gebäudehülle verbessert werden kann. So ließe sich die beste Effizienz erreichen.
„Wenn eine Wärmepumpe opitmal arbeitet, dann wandelt sie 1 KW Energie in 4 bis 5,5 KW um. Wenn die Temperaturen, die zum Heizen des Hauses benötigt werden, allerdings höher sind, dann fällt der Wirkungsgrad“, erläutert auch Alfred Keller. Dann sei sie eventuell ähnlich teuer wie eine Stromheizung.
Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe. Welche Schwierigkeiten bringen die unterschiedlichen Systeme mit sich?
Es gibt zum einen die Luft-Wasser-Wärmepumpen, die ihre Energie aus der Umgebungsluft ziehen. „Da haben wir oft das Problem mit der Aufstellung“, sagt Alfred Keller. Diese Wärmepumpen haben in etwa die Größe eines Kühlschranks und sind durch die Ventilatoren im Inneren auch eine Geräuschquelle.
„In der heutigen Bebauung haben wir kleine Grundstücke“, so Keller. So seien vorgeschriebene Abstände zum Nachbargrundstück nicht immer einzuhalten. Auch der Lärm durch die Heizungssysteme können zum Problem werden. „In reinen Wohngebieten oder etwa der Überlinger Altstadt ist das nahezu nicht mehr umsetzbar“, sagt Keller aus Erfahrung.
Auch die Installation von Wasser-Wasser-Wärmepumpen sei nicht so einfach umzusetzen, sagt der Heizungsexperte. „Der private Häuslebesitzer darf nicht so einfach Wasser aus Bächen, Seen oder Quellen fürs Heizen entnehmen.“ Das sei ein sehr aufwendiges Genehmigungsverfahren und wird selten genehmigt, da das Grundwasser erwärmt wird.
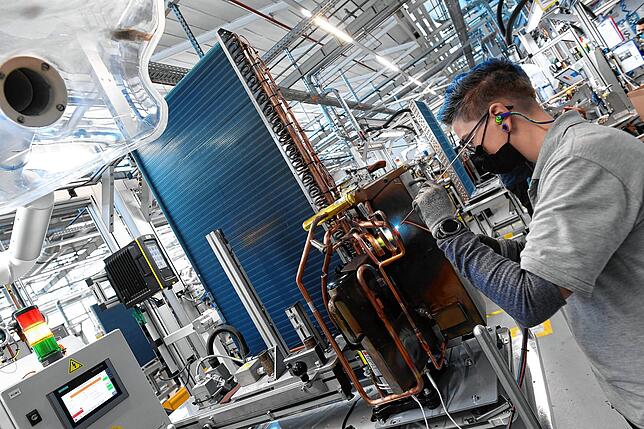
Bei Geothermie-Wärmepumpen wird in die Tiefe gebohrt und die Wärme aus dem Erdreich genutzt. „Die sind wirtschaftlich und energetisch sehr gut“, befindet Keller. Allerdings hätten die Bohrfirmen aktuell etwa ein Jahr Vorlaufzeit. In ganz Süddeutschland gebe es nur drei solcher Unternehmen.
Tschüss, alte Ölheizung! Welche Kosten kommen bei der Installation einer Wärmepumpe auf mich zu?
Wer die alte Ölheizung samt Kessel und Tank aus dem Keller schmeißen will, der muss mehrere Zehntausend Euro investieren. Bacher geht von bis zu 36.000 Euro aus, wenn anschließend das Haus über eine Wärmepumpe beheizt werden soll und die alten Tanks fachgerecht entsorgt werden sollen.
Allerdings winken derzeit zahlreiche Fördermöglichkeiten. Es gibt eine Grundförderung von 35 Prozent für den Einbau einer Wärmepumpe vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). „Wer seine alte Ölheizung durch eine mit Wärmepumpe ersetzt, der erhält 45 Prozent Förderung“, so Bacher. Ein zusätzlicher Zuschuss von 5 Prozent sei möglich, wenn im Vorfeld ein Sanierungsfahrplan erstellt würde.
Allerdings kosten auch die Zuschüsse Zeit und Nerven. Keller warnt vor: „Bei der Bearbeitung der Anträge gibt es momentan auch eine Vorlaufzeit von bis zu sieben Monaten bis der Verbraucher eine Antwort bekommt.“ Bis er die Vergütung erhalte, könne es bis zu einem Jahr dauern.
Wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit?
Auch in der Heizungsbranche gibt es Lieferschwierigkeiten. Die Industrie könne die Menge der nachgefragten Produkte gar nicht produzieren, da entscheidende Teile fehlten, erzählt Obermeister Keller. Er warte immer noch auf einen Liefertermin für eine Bestellung vom Dezember.
Zudem hat das Handwerk mehr Aufträge abzuarbeiten. Bis zu 15 Wochen müssten Kunden an Vorlaufzeit einplanen, so der Heizungsexperte vom Bodensee. Er rät dazu, langfristig zu planen: „Wir planen 2022, gebaut wird 2023.“

Auch die Preise steigen permanent. Das mache ein realistische Kalkulation schwer, so Keller. „2022 gab es schon zwei Preisanpassungen zwischen 6 und 14 Prozent – je nach Hersteller.“
Er habe keine andere Wahl als die zusätzlichen Kosten – auch für Energie und Treibstoff – an die Kunden weiterzugeben. „Aktuell haben wir eine Preisbindung von vier Wochen, danach muss neu verhandelt werden.“ Das lässt den Traum vom eigenen Haus für einige platzen. Keller kennt Bauherren, die vom Auftrag zurückgetreten sind, weil sie es sich nicht mehr leisten können.
Die Regierung möchte in den kommenden Jahren Millionen neue Wärmepumpen in deutsche Häuser bringen. Ist das realistisch?
Zusätzlich zu den Lieferschwierigkeiten kämpft das Handwerk mit der Masse an neuen Aufträgen. Er habe derzeit eine Sieben-Tage-Woche, sagt Keller. Nun möchte die Bundesregierung, dass bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen installiert werden. Doch dafür fehlt es an Fachkräften. Der BDH schätzt, das dafür 60.000 zusätzliche Monteure nötig wären.
Keller schätzt, dass bis zu 10.000 Fachkräfte alleine in Baden-Württemberg fehlen. Die Sanitär- und Klimabranche ist ein Gewinner der Energiewende. Doch laut Keller werde das Aufgabenspektrum durch Digitalisierung und Klimaziele ständig erweitert. „So schnell kann das Personal natürlich nicht nachwachsen.“
In meinem Haus ist die Installation einer Wärmepumpe nicht rentabel. Trotzdem muss die alte Ölheizung bald raus. Was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch?
„Beim Verbraucher kommt es ja gerade so an, dass es nur noch Wärmepumpen gibt“, bewertet Keller die Kommunikation in der Politik. „Aber wir dürfen und werden auch nach 2025 weiter Öl- und Gasheizungen bauen. Wir brauchen die fossilen Energieträger, weil sich bestimmte Häuser allein mit einer Wärmepumpe nicht heizen lassen.“
Ab 2025 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Gas- und Ölheizungen sollen dann als Hybride mit umweltfreundlicheren Systemen wie Photovoltaik laufen. Bei einer Wärmepumpe lässt sich das mit Ökostrom oder Strom aus der eigenen Solaranlage erreichen.
Erste Wahl von Tobias Bacher ist dann eine Hybridheizung, bei der die Wärmepumpe durch einen kleinen Pelletkessel ergänzt werde.









