Herr Thiel, wegen des Coronavirus stehen einige Menschen bereits unter Quarantäne, es droht uns allen sogar eine Ausgangssperre. Wie reagieren die Leute auf solche Situationen der Isolation?
Wenn Menschen räumlich und sozial isoliert werden, reagieren die meisten mit Stress-Symptomen und Angst. In dem Moment wird ihnen die Kontrolle über ihr Leben entzogen. Die Selbstbestimmung darüber, wo man hingehen kann und wen man wann trifft, geht verloren. Folge: Der Mensch fühlt sich hilflos. Manchmal kommt es allerdings zu einem interessanten Phänomen, das Psychologen Reaktanz nennen. Das bedeutet, man rebelliert, weil die Freiheit eingeschränkt ist, und tut genau das Gegenteil von dem, was erwünscht ist. Man hält sich zum Beispiel nicht an die momentanen Schutzregeln und trifft sich stattdessen mit Freunden im Park.
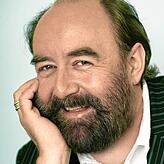
Warum kommt es zu solchen psychischen Reaktionen?
Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. Das heißt, er braucht das Gefühl, mit anderen wohlwollend zusammenleben zu können. Das gibt ihm das lebenswichtige Gefühl von Sicherheit. Schon zu Urzeiten war das so. Wurde ein Mensch allerdings aus der Gruppe ausgeschlossen, sozusagen aus der Höhle geworfen, dann sanken seine Überlebenschancen, weil mehr Gefahren drohten. Er fühlte sich allein gelassen und hatte berechtigte Existenzängste.
Und das hat sich bis heute gehalten?
Ja. Dieses Gefühl ist auch tausende Jahre später immer noch in uns drin. Erstens fühlen sich isolierte Menschen aussätzig und haben Angst, dass ihnen etwas Schlimmes droht. Zweitens spielt die Selbstbestimmung eine große Rolle: Jeder Mensch möchte das Gefühl haben, sein Leben selbst bestimmen können. Man will sozusagen der Kapitän auf seinem „Lebensschiff“ sein. Geht dies nicht, löst es Stress aus.
Und in diesem Zusammenhang spricht man dann vom Lagerkoller?
Genau. Gefühle wie Ausgrenzung und Selbstbestimmungsverlust spielen beim Lagerkoller eine Rolle, genauso wie das Gefühl, eingesperrt und zu eng mit anderen zusammen zu sein. Man kennt vielleicht das Bild vom Lagerkoller, wie eingesperrte Menschen ausrasten und durchdrehen, beispielsweise von Leuten im Gefängnis. Hier spricht man vom sogenannten Knastkoller. Es sind immer die gleichen Notfallreaktionen der Psyche wie Freiheitsdrang, Wut und Aggression. Entscheidend ist in allen Fällen, ob Rückzug und Isolation freiwillig oder erzwungen stattfinden. Erzwungene Umstände, die dem eigenen Charakter widersprechen, sind immer bedrohlich und können negative psychische Folgen haben.

Wovon hängt es ab, wie belastend eine solche Situation wahrgenommen wird?
Das ist individuell sehr unterschiedlich, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Es hängt stark vom Charakter ab, also wie man mit Alleinsein und Einschränkungen umgehen kann. Es gibt Menschen, die kommen sehr gut alleine klar. Sie sind dies auch gewohnt, brauchen nicht viele Menschen um sich herum und können diese Ruhe sogar genießen.
Für das Phänomen des Lagerkollers gibt es einige populäre Beispiele.
Was ist mit denen, die diese besonderen Fähigkeiten nicht besitzen?
Manche kommen mit einer Quarantäne natürlich schlechter klar. Sie fühlen sich nach kurzer Zeit unwohl und spüren innere Unruhe und Angst. Den einen kann der tägliche Umgang mit einer vertrauten Gruppe wie der Familie helfen, andere wiederum fühlen sich davon bedrängt und werden wahnsinnig. Man kann daher auch nicht pauschal festlegen, nach wie vielen Tagen wem ein Lagerkoller droht.
Was spielt neben charakterlichen Eigenschaften in der Quarantäne-Situation auch eine Rolle?
Der Ort und die Menschen, von denen man umgeben ist, spielen eine große Rolle. Man kann hier verschiedene Abstufungen machen. Wenn man weit weg von zuhause eingesperrt ist, möglicherweise auch mit Menschen, die eine andere Sprache sprechen, wird die Lage bedrohlicher wahrgenommen. Im eigenen Zuhause mit Menschen, die die gegenseitigen Bedürfnisse kennen, ist es einfacher. Innerhalb einer Familie treten eher die üblichen Alltagsprobleme und Streitereien auf. Eine neue Situation dagegen ist bedrohlicher und stressiger.
Wie kann man einem Lagerkoller vorbeugen?
Alleine zu wissen, dass ein Lagerkoller droht, kann einem dabei helfen, ihm vorzubeugen. Man sollte versuchen, die Zeit sinnvoll zu nutzen und bereits jetzt für die Zeit zu planen. Für Erwachsene bietet es sich an, im Home Office zu arbeiten oder Tätigkeiten im Haushalt nachzugehen, zu denen man sonst nicht kommt. Auch Kinder können sich darauf vorbereiten, indem sie von Schulen mit Hausaufgaben versorgt werden. Dadurch behalten sie ihre Tagesstruktur und einen Sinn bei. Es ist wichtig, sich rechtzeitig Pläne zu machen, wie man einen Rhythmus beibehalten kann.
Welche Tipps helfen uns während der Quarantäne?
Das Wichtigste ist, innerhalb der Gruppe auf die gegenseitigen Bedürfnisse von Nähe und Distanz zu achten, also gemeinsame und getrennte Zeiten im Wechsel zu gestalten. Wenn jemand beispielsweise innerhalb der Familie mal seine Ruhe braucht, sollte man ihm diese unbedingt geben, genauso, wie manche die gemeinsame Kuschelzeit brauchen. Einsamen Menschen kann man durch regelmäßige Anrufe helfen. Generell können dann auch moderne Medien und Kommunikationsmittel helfen.
Gerade für Personen, die viel menschlichen Kontakt brauchen, kann es gut sein, viel zu telefonieren und sich online in Gruppen zum Spielen oder Schreiben zu organisieren. In Familien können ganz klassische Brettspiele wie Mensch-ärgere-dich-nicht wieder ausgepackt werden. Wichtig ist, sich zu sagen „wir machen jetzt das Beste daraus“, anstatt nur die negativen Seiten zu sehen. Psychologen nennen diesen Vorgang Reframing: Aus einer erzwungenen und bedrohlichen Situation etwas Positives machen und den Sinn darin suchen. Innerhalb einer Familie kann man sich zum Beispiel erst mal darüber freuen, dass es einem selbst und den anderen gut geht, dass man nicht schlimm erkrankt ist, und so die gemeinsame Zeit genießen oder für aufgeschobene Dinge nutzen kann.

Wann ist professionelle Hilfe nötig?
Bei Menschen, die bereits unter einer Depression oder einer Angststörung leiden, kann psychologische Hilfe durchaus hilfreich sein, da eine Zwangssituation die bereits vorhandenen Symptome verstärken kann. Dafür gibt es zum Beispiel verschiedene Telefonhotlines, die Seelsorge oder einfach nur Gespräche anbieten. Niemand sollte hier zögern oder sich dafür schämen, dort anzurufen. Auch Psychotherapeuten sind natürlich weiterhin erreichbar, gerade für Menschen, die bereits in Therapie sind.
Kann ein Lagerkoller langfristige psychische Auswirkungen haben?
Das hängt davon ab, wie schlimm die Situation wahrgenommen wurde. Den meisten wird es wieder besser gehen, sobald sich die Situation normalisiert. Starker Stress und Angst können aber Traumata auslösen, die sich in der Psyche festsetzen und auch nach der Isolation bestehen bleiben. Wenn Ängste oder Albträume etwa drei bis fünf Wochen nach Ende der Quarantäne noch immer da sind, sollte man sich nicht scheuen, ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Derzeit führt Michael Thiel einen Podcast für Kinder in Coronazeiten. Sie finden ihn hier.





